Such den Bono
Pro-Bono auf Nobono! Es muss an dieser Stelle auch endlich mal U2 etwas Platz eingeräumt werden. Deren aktuelles Showprogramm machte jetzt u.a. Halt in Hannover. Hier meine subjektiven Eindrücke...
PS: Die Fotos stammen allesamt von der Homepage von NDR2.
Seit nunmehr über dreieinhalb Jahren schreibe ich nun schon meine diversen Gedanken zu Musik aus den Bereichen Rock/ Pop, Indie und was weiß ich hier auf diesem kleinen Blog, welche „Nobono“ heißt. Ich hab nie ganz kapiert, warum der Blog so heißt, aber die ehemaligen Gründer haben sich eh längst in den Vorruhestand verabschiedet, weshalb man das als urbanes Mysterium in den Akten vermerken kann. Ungeachtet morphologischer Gesetzgebung muss es aber was mit deren Antipathie für Bono Vox, Frontprediger der irischen Stadionrocker von U2 zu tun haben. Und ebenso lange habe ich mich auf einen triumphalen Bericht zu dieser Band, welche ich ja eigentlich mag, hier gefreut, denn die Überschrift, „Yes! Bono!“ stand schon seit genauso langer Zeit fest und sollte nun angesichts meines Konzertbesuches bei den vier Herren endlich ihre Verwendung finden. Aber am Ende kommt ja bekanntlich immer alles anders. Aber fangen wir mal kurz am Anfang an.
Bono hatte Rücken. Kann man ja auch mal haben mit 50. Einem Bandscheibenvorfall war es zu verdanken, dass die aktuelle „360° Tour“ ein paar Wochen Pause machen musste. Finanzielle Verluste in dreistelliger Millionenhöhe inklusive. Und deshalb müssen U2 jetzt noch bis weit in 2011 rein weitertouren. Nicht nur wegen der schwarzen Zahlen. Man will ja auch. Das entsprechende Statussymbol hat man ja schon dabei: Die Kraaaalleeee! Nach Turin und Frankfurt war Hannover diesen Donnerstag erst die dritte Station nach dem Wiederanpfiff. Nachdem ich U2 vergangenen Sommer auf ihren beiden Daten verpasst hatte, nun also die Chance, fünf Jahre nach dem ersten und sehr gut in meiner Erinnerung gebliebenen Konzert in Berlin, die Band noch mal live zu erleben. Man weiß ja nie, wie viele Chancen man noch bekommt. Die AWD-Arena ist glücklicherweise nicht riesig und der Ansturm hielt sich in Grenzen, so dass es sich zum Glück nicht unbedingt rentierte, sich 11 Uhr schon anzustellen. Auch nach 17 Uhr kam man noch relativ gesittet in den vorderen Bereich der Bühne. Ja, die Bühne. Viel wurde schon über die Kralle geredet. Revolutionär, riesig, gigantisch, einmalig! Ja, schon irgendwie. Aber auch eine beängstigende Art und Weise. Ich meine, klar, wir reden hier von der Band, die 1997 auf der „PopMart“ Tour die größte Leinwand ever dabei hatte und dazu noch eine ebenfalls beachtlich große Zitrone, aus welcher sie emporstiegen. Aber der Overkill gehörte eh zum 90er-Jahre-Konzept der Band. Damals war das alles bewusst übertrieben, ironisch und konsequent live, sowie auf Platte, durchgezogen. Aber heute? Heute wirkt es nur wie eine groteske Spielerei, deren Mehrwert sich eigentlich auch in Grenzen hält, wie man live feststellen sollte. Na ja, eines nach dem anderen. Erstmal heißt es relativ lange im abgetrennten Raum vor bzw. rund um die Bühne warten. Unvermeidlicher Nebeneffekt von Konzerten in dieser Größenordnung. Irgendwann enterten dann Kasabian die Bühne und gaben einen ganz okayen Support Act ab. Da ich die an anderer Stelle schon mal live gesehen hatte, wusste ich von deren Live-Qualitäten. Gerade in der Heimat sind die diesbezüglich ja eine Macht, hier sind sie mehr ein (Achtung, Wortspiel mit Band-Song) „Underdog“. Aber man arbeitet dran, spielt ein solides Set an „Hits“ aus den ersten drei Alben und Frontmann Tom Meighan übt sich als Crowd-Anheizer mit dem gewissen Mix aus Lausbuben-Image und Arroganz. Nützt aber nix. Der Sound ist mies und das Publikum ist eher damit beschäftigt, den Bierpegel in die Höhe zu treiben. Neue Zielgruppen erschließt man hier sicher schwer. Aber solange sich unter den knapp 50.000 Leuten eine Handvoll Interessierter und potentieller Käufer findet, hat sich das Ganze ja schon gelohnt. Ein lukrativer Sommerjob halt für mittelgroße Bands. Und das hat sich ja rumgesprochen. Fragen sie mal Snow Patrol oder Interpol.
Dann heißt es wieder weiter warten. Und der Innenraum füllt sich dann doch langsam aber sicher. Leider mit dem Publikum, das man angesichts einer Band, die ihr Debütalbum vor dreißig Jahren veröffentlicht hat, durchaus erwarten kann. Aber ich meine, mit 26 bewege ich mich ja auch langsam in diese Bereiche vor. Leider trennt sich da einiges und meist hat man das Gefühl, die Spreu bleibt übrig. Und für die Damen und Herren ist ein U2-Konzert in erster Linie natürlich ein Event. Willkommene Abwechslung vom Alltag. Sicher, man mag auch die Band und die alten Platten und so, aber Hauptsache es ist mal wieder was los in der Stadt. Fehlt ja nur eine Plane und Kralle wäre ein tolles Zirkuszelt. Na ja, also werden viele T-Shirts gekauft oder selbergedruckt und sich vor allem reichlich mit Bier eingedeckt. Die ganze Zeit! Und in Massen. Der finanzielle Tourausfall-Verlust wird weg gesoffen! Und so sind alle lustig drauf, fotografieren sich immer wieder vor der Kralle oder einem Ordner oder und stimmen lustige „Wir wollen den Bono sehen“-Sprechchöre an. Die gelungene Abwechslung vom Büroalltag ist ja auch jedem zu gönnen. Festivals sind eh nicht mehr in deren Zielgruppenbereich und ja sowieso viel zu kompliziert, schmutzig und aufwendig. Also fokussiert sich dies gern mal auf einzelne Events alter Helden. Depeche Mode sind auch so Favoriten, das hab ich letztes Jahr gemerkt. Ironischerweise läuft auch „Enjoy The Silence“ in der Aufwärmphase. Ein Raunen geht durch die Menschen. Der Rest der Musik entpuppt sich als überraschend tagesaktueller Mix aus feinsten Indie-Perlen, aber da hat jemand eindeutig an der Zielgruppe vorbeioperiert. Aber zumindest hatte er gute Ambitionen. Na ja, erstmal ein Bier. Und noch eines. 5 Euro für nen halben Liter? O zapft is! Einige haben zu Konzertbeginn anscheinend schon genug. Die Fremdschämquote steigt ein wenig. Ein Hoch auf meine, ebenfalls anwesenden und anständigen Eltern! Ich bleibe bei einem „Ich kann mich auch ohne Alkohol amüsieren“ und komme dann mal zur Hauptband des Abends. Die gab’s ja auch noch.
 Kurz vor 21 Uhr betraten die vier viel umjubelten Iren zu den Klängen von David Bowie’s „Space Oddity“ die Bühne und lassen sich erstmal ordentlich vom Hannover Publikum feiern. Als Intro fungiert ein neues Instrumental-Stück. Ja, The Edge war während Bonos Reha durchaus produktiv. Es folgt „Beautiful Day“, eine fast schon zu sichere Wahl für den ersten Song. Der Zirkus beginnt, Manege frei für die Megastars. Es folgt relativ wenig vom aktuellen Album „No Line On The Horizon“, weil… ja, warum eigentlich? U2 gehen auf Nummer sicher und liefern ein paar gute Evergreens. Und so hat man während Songs wie „New Years Day“, „Mysterious Ways“ oder „Elevation“ Zeit sich mit der Bühne und ihren positiven, wie negativen Eigenarten auseinanderzusetzen. Das Spiel „Such den Bono“ wird mal eben ruckzuck zum Publikumsrenner, denn die Möglichkeit, sich entweder auf der Bühne oder per Brückenüberquerung auch auf dem Außenkreis zu bewegen nutzen alle Bandmitglieder. Die Brücken bewegen sich übrigens auch noch. Das führt natürlich zu feinen Momenten, wenn Bono auf einmal in gerade mal zwei Meter Entfernung über einem steht und „Hallo“ sagt. Da wird selbst ein mittelmäßiger Song wie „City Of Blinding Lights“ zum Erlebnis. Das Publikum wendet seine Gesichter, egal, ob Bono, The Edge oder Adam Clayton, immer Richtung Rockstar. Und natürlich wird da alles an iPhones, Fotohandys und Digi-Cams gezückt, was das Inventar zu bieten hat. Also hält man permanent die Augen auf. Wie ein Paparazzi sucht man das beste Motiv und die Nähe zum Star. Das führt dann aber auch gern mal zu frustrierenden Momenten, wenn Bono zum Beispiel beim 84er Klassiker „The Unforgettable Fire“ gar nicht zu erspähen ist. Die Konzertsozialisierung der letzten Jahrzehnte nötig jeden, den Fixpunkt Bono zu suchen, aber er ist halt einfach nicht da. Dabei ist The Edge ja auch noch da. Und generell… sollte es nicht um die Musik gehen? Na ja, etwas Show muss auch sein. Und “etwas” ist in diesem Fall halt viiiiel Technik. Allein bei der Vorstellung darüber, wie teuer die ausklappbare LCD-Wand gekostet hat, wird mir schlecht. Ich versuche die existenten, gleichzeitg herum reisenden drei (!) Krallen, ihre Produktions- und Transportkosten auszurechen und das in Relation mit… sagen wir mal, humanitärer Hilfe für Afrika (Wunder Punkt, Herr Vox) zu setzen… aber beim Rechnen wird mir schlecht. Ich bleibe bei ungläubigem Kopfschütteln. Hätte etwas weniger nicht auch den gleichen Effekt gehabt? Das Herumlaufen der Protagonisten wirkt nicht nur extrem einstudiert, sondern entpuppt sich auch eher als Gimmick. Die Höhe der Bühne dürfte für Genickstarre der Personen vorne sorgen und generell… das Anliegen, das alle mehr sehen können ist eher eine Lüge. Vielmehr lassen sich dadurch noch ein paar billige Plätze hinter der Bühne verkaufen. Ein Schelm, der böses dabei denkt. Die Kartenkäufer dürften sich freuen, denn prinzipiell ist die Kralle immer noch eine klassische Bühne, halt mit offener Rückwand und nem etwas längeren Rundum-Steg. Die Band agiert aber einen Großteil des Konzertes nach vorn gewandt. Immerhin steht die Bühne ja auch nicht in der Mitte des Stadions. Der Effekt besteht in der Größe, die jeden Normalbürger erschlägt und im Showkonzept, bei dem die Band sich gern mal als Insassen ihres riesigen Raumschiffes präsentiert. Bonos Roboteransprache wirkt da sogar relativ witzig. Ansonsten liefert der gute Mann die Show, die man von ihm erwartet. Etwas schreien, etwas gestikulieren und vor allem viel trinken. Hat der Doktor wohl gesagt. Ansonsten animiert Bono halt auch viel zum mitsingen, was sich natürlich bei Stadion-Allzweckwaffen, wie „I Still Haven’t Found What I’m Looking For“ als todsicheres Mittel entpuppt, um zum einen Gänsehaut zu erzeugen und zum anderen, den letzten Stillsitzer zu motivieren. Bonos Stimme macht einen guten Eindruck. Sie klingt sowieso schon lange nicht mehr wie 1991 und die Tagesform spielt mittlerweile leider eine entscheidende Rolle (Negativ: siehe die letzten beiden Live-DVDs).
Kurz vor 21 Uhr betraten die vier viel umjubelten Iren zu den Klängen von David Bowie’s „Space Oddity“ die Bühne und lassen sich erstmal ordentlich vom Hannover Publikum feiern. Als Intro fungiert ein neues Instrumental-Stück. Ja, The Edge war während Bonos Reha durchaus produktiv. Es folgt „Beautiful Day“, eine fast schon zu sichere Wahl für den ersten Song. Der Zirkus beginnt, Manege frei für die Megastars. Es folgt relativ wenig vom aktuellen Album „No Line On The Horizon“, weil… ja, warum eigentlich? U2 gehen auf Nummer sicher und liefern ein paar gute Evergreens. Und so hat man während Songs wie „New Years Day“, „Mysterious Ways“ oder „Elevation“ Zeit sich mit der Bühne und ihren positiven, wie negativen Eigenarten auseinanderzusetzen. Das Spiel „Such den Bono“ wird mal eben ruckzuck zum Publikumsrenner, denn die Möglichkeit, sich entweder auf der Bühne oder per Brückenüberquerung auch auf dem Außenkreis zu bewegen nutzen alle Bandmitglieder. Die Brücken bewegen sich übrigens auch noch. Das führt natürlich zu feinen Momenten, wenn Bono auf einmal in gerade mal zwei Meter Entfernung über einem steht und „Hallo“ sagt. Da wird selbst ein mittelmäßiger Song wie „City Of Blinding Lights“ zum Erlebnis. Das Publikum wendet seine Gesichter, egal, ob Bono, The Edge oder Adam Clayton, immer Richtung Rockstar. Und natürlich wird da alles an iPhones, Fotohandys und Digi-Cams gezückt, was das Inventar zu bieten hat. Also hält man permanent die Augen auf. Wie ein Paparazzi sucht man das beste Motiv und die Nähe zum Star. Das führt dann aber auch gern mal zu frustrierenden Momenten, wenn Bono zum Beispiel beim 84er Klassiker „The Unforgettable Fire“ gar nicht zu erspähen ist. Die Konzertsozialisierung der letzten Jahrzehnte nötig jeden, den Fixpunkt Bono zu suchen, aber er ist halt einfach nicht da. Dabei ist The Edge ja auch noch da. Und generell… sollte es nicht um die Musik gehen? Na ja, etwas Show muss auch sein. Und “etwas” ist in diesem Fall halt viiiiel Technik. Allein bei der Vorstellung darüber, wie teuer die ausklappbare LCD-Wand gekostet hat, wird mir schlecht. Ich versuche die existenten, gleichzeitg herum reisenden drei (!) Krallen, ihre Produktions- und Transportkosten auszurechen und das in Relation mit… sagen wir mal, humanitärer Hilfe für Afrika (Wunder Punkt, Herr Vox) zu setzen… aber beim Rechnen wird mir schlecht. Ich bleibe bei ungläubigem Kopfschütteln. Hätte etwas weniger nicht auch den gleichen Effekt gehabt? Das Herumlaufen der Protagonisten wirkt nicht nur extrem einstudiert, sondern entpuppt sich auch eher als Gimmick. Die Höhe der Bühne dürfte für Genickstarre der Personen vorne sorgen und generell… das Anliegen, das alle mehr sehen können ist eher eine Lüge. Vielmehr lassen sich dadurch noch ein paar billige Plätze hinter der Bühne verkaufen. Ein Schelm, der böses dabei denkt. Die Kartenkäufer dürften sich freuen, denn prinzipiell ist die Kralle immer noch eine klassische Bühne, halt mit offener Rückwand und nem etwas längeren Rundum-Steg. Die Band agiert aber einen Großteil des Konzertes nach vorn gewandt. Immerhin steht die Bühne ja auch nicht in der Mitte des Stadions. Der Effekt besteht in der Größe, die jeden Normalbürger erschlägt und im Showkonzept, bei dem die Band sich gern mal als Insassen ihres riesigen Raumschiffes präsentiert. Bonos Roboteransprache wirkt da sogar relativ witzig. Ansonsten liefert der gute Mann die Show, die man von ihm erwartet. Etwas schreien, etwas gestikulieren und vor allem viel trinken. Hat der Doktor wohl gesagt. Ansonsten animiert Bono halt auch viel zum mitsingen, was sich natürlich bei Stadion-Allzweckwaffen, wie „I Still Haven’t Found What I’m Looking For“ als todsicheres Mittel entpuppt, um zum einen Gänsehaut zu erzeugen und zum anderen, den letzten Stillsitzer zu motivieren. Bonos Stimme macht einen guten Eindruck. Sie klingt sowieso schon lange nicht mehr wie 1991 und die Tagesform spielt mittlerweile leider eine entscheidende Rolle (Negativ: siehe die letzten beiden Live-DVDs).  An diesem Abend klappt alles und das sorgt gelegentlich für tolle Momente, etwa wenn man mal kurz das Singles-Gerüst verlässt und einen ganz neuen Track, wie das krachige „Glastonbury“ spielt. Oder der zehn Jahre alte Album-Track „In A Little While“. Richtig schön wird es bei „Miss Sarajevo“, dem Song, der einst für das Seitenprojekt „Passangers“ mit Brian Eno, Mitte der 90er, entstand. Die traurige Ballade vom Schönheitswettbewerb im kriegsgebeutelten Sarajevo der 90er wird sehr reduziert vorgetragen. Die Stimme von Duettpartner Luciano Pavarotti ist mittlerweile leider für immer verstummt, aber Bono singt den Opern-Part auf magische Weise einfach selber und erzeugt phänomenalen Jubel. Ein großer Moment, auf den Punkt genau funktionierend. Vielleicht der schönste des ganzen Abends und das Argument, was für „Yes, Bono!“ als Überschrift spricht. Denn U2 haben in ihrer Karriere großartige Songs geschrieben. Sicher, die Hits wurden tot gespielt, wenngleich sie ja im Prinzip immer noch gute Songs sind. Aber auch abseits davon haben U2 Brillantes geschaffen. Deshalb halte ich ihnen auch die Treue, wenngleich die letzten zehn Jahre nicht mehr sooo viel von dieser Brillanz zeigen, wie frühere Taten. Aber nach drei Jahrzehnten noch auf diesem Level zu spielen und sich dabei musikalisch immer wieder selbst zu puschen… da gehört schon Einiges dazu. Und diese Band spielt immer noch im Original Line-Up. Da sind vier Freunde auf der Bühne, das merkt man. Selbst wenn sie an diesem Abend eher Pflichterfüllung betreiben und es Bono sichtlich schwer fällt, die Leute beim schnittigen, aber etwas fremdartig wirkenden, Dance-Teil zu „I’ll Go Crazy If I Don’t Go Crazy Tonight“ zum Ausflippen zu bringen. Wer wedelt mit den Armen, aber kommt nicht gegen den eigenen Schatten aus Hits und der Erwartungshaltung des Publikums an. Schade eigentlich.
An diesem Abend klappt alles und das sorgt gelegentlich für tolle Momente, etwa wenn man mal kurz das Singles-Gerüst verlässt und einen ganz neuen Track, wie das krachige „Glastonbury“ spielt. Oder der zehn Jahre alte Album-Track „In A Little While“. Richtig schön wird es bei „Miss Sarajevo“, dem Song, der einst für das Seitenprojekt „Passangers“ mit Brian Eno, Mitte der 90er, entstand. Die traurige Ballade vom Schönheitswettbewerb im kriegsgebeutelten Sarajevo der 90er wird sehr reduziert vorgetragen. Die Stimme von Duettpartner Luciano Pavarotti ist mittlerweile leider für immer verstummt, aber Bono singt den Opern-Part auf magische Weise einfach selber und erzeugt phänomenalen Jubel. Ein großer Moment, auf den Punkt genau funktionierend. Vielleicht der schönste des ganzen Abends und das Argument, was für „Yes, Bono!“ als Überschrift spricht. Denn U2 haben in ihrer Karriere großartige Songs geschrieben. Sicher, die Hits wurden tot gespielt, wenngleich sie ja im Prinzip immer noch gute Songs sind. Aber auch abseits davon haben U2 Brillantes geschaffen. Deshalb halte ich ihnen auch die Treue, wenngleich die letzten zehn Jahre nicht mehr sooo viel von dieser Brillanz zeigen, wie frühere Taten. Aber nach drei Jahrzehnten noch auf diesem Level zu spielen und sich dabei musikalisch immer wieder selbst zu puschen… da gehört schon Einiges dazu. Und diese Band spielt immer noch im Original Line-Up. Da sind vier Freunde auf der Bühne, das merkt man. Selbst wenn sie an diesem Abend eher Pflichterfüllung betreiben und es Bono sichtlich schwer fällt, die Leute beim schnittigen, aber etwas fremdartig wirkenden, Dance-Teil zu „I’ll Go Crazy If I Don’t Go Crazy Tonight“ zum Ausflippen zu bringen. Wer wedelt mit den Armen, aber kommt nicht gegen den eigenen Schatten aus Hits und der Erwartungshaltung des Publikums an. Schade eigentlich.
 Schade auch deshalb, weil die Band selber ja noch einigermaßen fit in der Birne ist und musikalisch noch vieles erreichen möchte. Immerhin sind laut Bono gerade drei Alben-Konzepte in der Entwicklung. Mal sehen, wieviel davon am Ende übrig bleibt. Aber aufs Altenteil kann und will man sich wohl noch nicht zurückziehen, was sehr vorbildlich ist. Live hinterlässt das Ganze dann doch irgendwie einen etwas uneuphorischen Beigeschmack. Je größer die Show und die Technik dahinter, desto durchgeplanter und auch irgendwie seelenloser wirkt das Ganze. Selbst Bono beschreibt das Ganze irgendwie passenderweise als ein Volksfest mit hoher Bierquote. Das Spektakel steht im Vorder-, die Musik im Hintergrund. Sicher, wenn dann bei „With Or Without You“ mal die Ehefrau kurz in den Arm genommen wird, ist das schon anrührend, bleibt aber nur eine Momentaufnahme. Showbiz pur, da wirken selbst die obligatorischen politischen Einsprenkler ein wenig fehl am Platz. Seit jeher ein Streitthema, anscheinend auch unter den Fans. Als zwischen den Zugaben eine Rede von Desmond Tutu über die Leinwand flimmert, in dem er die Leute weiterhin zum Kampf gegen die Armut in Afrika ermuntert, gibt es auch vereinzelte Pfiffe, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob die jetzt aus Begeisterung entstanden sind. Für das schlechte Gewissen ist kein Platz beim Volksfest. Gejubelt wird beim anschließenden "One" aber dennoch. Nett sind diese Momente aber trotzdem. Und wichtig! Was macht denn eigentlich die Revolutionsbewegung in Theheran? Hätte Bono ja mal besseres Update geben können. Das abschließende "Moment Of Surrender" dann noch Robert Enke zu widmen (inkl. Larry Mullen Jr. im "Hannover-96"-Trikot) ist ebenfalls höchst ehrbar und
Schade auch deshalb, weil die Band selber ja noch einigermaßen fit in der Birne ist und musikalisch noch vieles erreichen möchte. Immerhin sind laut Bono gerade drei Alben-Konzepte in der Entwicklung. Mal sehen, wieviel davon am Ende übrig bleibt. Aber aufs Altenteil kann und will man sich wohl noch nicht zurückziehen, was sehr vorbildlich ist. Live hinterlässt das Ganze dann doch irgendwie einen etwas uneuphorischen Beigeschmack. Je größer die Show und die Technik dahinter, desto durchgeplanter und auch irgendwie seelenloser wirkt das Ganze. Selbst Bono beschreibt das Ganze irgendwie passenderweise als ein Volksfest mit hoher Bierquote. Das Spektakel steht im Vorder-, die Musik im Hintergrund. Sicher, wenn dann bei „With Or Without You“ mal die Ehefrau kurz in den Arm genommen wird, ist das schon anrührend, bleibt aber nur eine Momentaufnahme. Showbiz pur, da wirken selbst die obligatorischen politischen Einsprenkler ein wenig fehl am Platz. Seit jeher ein Streitthema, anscheinend auch unter den Fans. Als zwischen den Zugaben eine Rede von Desmond Tutu über die Leinwand flimmert, in dem er die Leute weiterhin zum Kampf gegen die Armut in Afrika ermuntert, gibt es auch vereinzelte Pfiffe, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob die jetzt aus Begeisterung entstanden sind. Für das schlechte Gewissen ist kein Platz beim Volksfest. Gejubelt wird beim anschließenden "One" aber dennoch. Nett sind diese Momente aber trotzdem. Und wichtig! Was macht denn eigentlich die Revolutionsbewegung in Theheran? Hätte Bono ja mal besseres Update geben können. Das abschließende "Moment Of Surrender" dann noch Robert Enke zu widmen (inkl. Larry Mullen Jr. im "Hannover-96"-Trikot) ist ebenfalls höchst ehrbar und
scheint die Menschen eher zu bewegen, als Amnestys Alltagssorgen oder das Schicksal von Freiheitskämpferin Aung San Suu Kyi in Burma. Aber für seine politischen Botschaften bieten die Shows für Bono die gleiche lukrative Möglichkeit, wie der Sommerjob von Kasabian und Co. ... Wenn schon ein paar Dutzend Menschen sich Gedanken machen, ihre Unterschrift geben und Umdenken, dann ist das schon ein Erfolg. Da muss man sich kleine Maßstäbe setzen. Aber ich möchte hier nicht alles schlecht reden, denn diese Show bot auch sehr viel Gutes. Mehr gutes, als schlechtes. Die Schauwerte sind beeindruckend, besonders wenn man sie richtig einsetzt. So z.B. bei "Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me" aus dem Jahr 1995, bei dem die einstige "Coolness"
der Band nochmal durchblitzt. Düster, Experimentell und irgendwie mit subtiler Erotik untersetzt... dass diese Anti-Hymne damals das erste Stück Musik war, dass ich je von U2 gehört habe, hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Irgendwo zwischen Zoo TV und PopMart entstanden, also zur Hochphase, als U2 ihr Gigantomanie-Konzept auch künstlerisch einfach mal auf die Spitze getrieben haben, inkl. Kostümen und Kunstfiguren. Von MacPhisto ist
mittlerweile nur noch ein bisschen reflektierendes Rotlicht in Bonos Spiegeljacke geblieben. Die wilden Zeiten sind vorbei. Irgendwie traurig, aber der Lauf des Lebens. Schätz ich mal.
Am Ende gehen die Lichter an, der Jubel ist groß und die Band verschwindet wieder in den Katakomben des Stadions. Wer noch kein Foto vor der Kralle gemacht hat, tut dies jetzt. Ein weiteres Bier wird angesichts des Andrangs schwer werden. Nach der Show ist vor der Show. U2 ziehen weiter durch die Welt, die nächste Bühne wird ja schon anderorts aufgebaut. Und das Fazit? Nein, das ist jetzt nicht total vernichtend, aber auch kein euphorisches "Yes, Bono!" U2 sind und bleiben eine großartige Band. Um sich das immer wieder zu bestätigen muss man nur mal deren musikalisches Schaffen in den letzten 30 Jahren betrachten und all die musikalischen Genres, die sie da abgegrast haben. Absolute Beständigkeit und Hitquote. Aber das bringt halt nach so langer
Zeit an der Weltspitze auch einige Schattenseiten mit sich. Sinkende Risikobereitschaft (Setlist) und akuter Größenwahn (Bühne) sowieso. Das raubt den eigentlich sehr tollen Songs ein wenig die Seele und das Gefühl, zumal diese Faktoren bei manchen auch gar nicht wichtig zu sein scheinen. Es war schön, die einstigen Helden nochmal live und vor allem relativ nahe gesehen zu haben. Und vermutlich sollte ich auch nicht so naiv sein und hier mehr erwarten, als dies der Fall ist. Konzerte in dieser Größenordnung sind Events mit zig anderen Faktoren und Nebenerscheinungen. Das ist schon in Ordnung so. Jeder nach seiner Farcon. Meine ist's auf Dauer jedenfalls nicht. Vielleicht denken ja dann selbst die irischen Volkshelden nochmal um, und versuchen sich nicht auf Teufel komm raus, immer wieder selbst zu toppen. Da ist die Obergrenzen nämlich irgendwie auch langsam
erreicht. Selbst beim Größenwahn gilt: weniger ist manchmal eben doch mehr. Dann wird das vielleicht nochmal was mit der Überschrift.
Setlist:
01 Return of the Stingray Guitar
02 Beautiful Day
03 New Year's Day
04 Get On Your Boots
05 Magnificent
06 Mysterious Ways
07 Elevation
08 I Still Haven't Found What I'm Looking For
09 Glastonbury
10 In A Little While
11 Miss Sarajevo
12 Until the End of the World
13 The Unforgettable Fire
14 City of Blinding Lights
15 Vertigo
16 I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight (Remix)/ Discotheque
17 Sunday Bloody Sunday
18 MLK
19 Walk On
20 One
21 Where the Streets Have No Name
22 Hold Me Thrill Me Kiss Me Kill Me
23 With or Without You
24 Moment of Surrender
PS: Die Fotos stammen allesamt von der Homepage von NDR2.
Seit nunmehr über dreieinhalb Jahren schreibe ich nun schon meine diversen Gedanken zu Musik aus den Bereichen Rock/ Pop, Indie und was weiß ich hier auf diesem kleinen Blog, welche „Nobono“ heißt. Ich hab nie ganz kapiert, warum der Blog so heißt, aber die ehemaligen Gründer haben sich eh längst in den Vorruhestand verabschiedet, weshalb man das als urbanes Mysterium in den Akten vermerken kann. Ungeachtet morphologischer Gesetzgebung muss es aber was mit deren Antipathie für Bono Vox, Frontprediger der irischen Stadionrocker von U2 zu tun haben. Und ebenso lange habe ich mich auf einen triumphalen Bericht zu dieser Band, welche ich ja eigentlich mag, hier gefreut, denn die Überschrift, „Yes! Bono!“ stand schon seit genauso langer Zeit fest und sollte nun angesichts meines Konzertbesuches bei den vier Herren endlich ihre Verwendung finden. Aber am Ende kommt ja bekanntlich immer alles anders. Aber fangen wir mal kurz am Anfang an.
Bono hatte Rücken. Kann man ja auch mal haben mit 50. Einem Bandscheibenvorfall war es zu verdanken, dass die aktuelle „360° Tour“ ein paar Wochen Pause machen musste. Finanzielle Verluste in dreistelliger Millionenhöhe inklusive. Und deshalb müssen U2 jetzt noch bis weit in 2011 rein weitertouren. Nicht nur wegen der schwarzen Zahlen. Man will ja auch. Das entsprechende Statussymbol hat man ja schon dabei: Die Kraaaalleeee! Nach Turin und Frankfurt war Hannover diesen Donnerstag erst die dritte Station nach dem Wiederanpfiff. Nachdem ich U2 vergangenen Sommer auf ihren beiden Daten verpasst hatte, nun also die Chance, fünf Jahre nach dem ersten und sehr gut in meiner Erinnerung gebliebenen Konzert in Berlin, die Band noch mal live zu erleben. Man weiß ja nie, wie viele Chancen man noch bekommt. Die AWD-Arena ist glücklicherweise nicht riesig und der Ansturm hielt sich in Grenzen, so dass es sich zum Glück nicht unbedingt rentierte, sich 11 Uhr schon anzustellen. Auch nach 17 Uhr kam man noch relativ gesittet in den vorderen Bereich der Bühne. Ja, die Bühne. Viel wurde schon über die Kralle geredet. Revolutionär, riesig, gigantisch, einmalig! Ja, schon irgendwie. Aber auch eine beängstigende Art und Weise. Ich meine, klar, wir reden hier von der Band, die 1997 auf der „PopMart“ Tour die größte Leinwand ever dabei hatte und dazu noch eine ebenfalls beachtlich große Zitrone, aus welcher sie emporstiegen. Aber der Overkill gehörte eh zum 90er-Jahre-Konzept der Band. Damals war das alles bewusst übertrieben, ironisch und konsequent live, sowie auf Platte, durchgezogen. Aber heute? Heute wirkt es nur wie eine groteske Spielerei, deren Mehrwert sich eigentlich auch in Grenzen hält, wie man live feststellen sollte. Na ja, eines nach dem anderen. Erstmal heißt es relativ lange im abgetrennten Raum vor bzw. rund um die Bühne warten. Unvermeidlicher Nebeneffekt von Konzerten in dieser Größenordnung. Irgendwann enterten dann Kasabian die Bühne und gaben einen ganz okayen Support Act ab. Da ich die an anderer Stelle schon mal live gesehen hatte, wusste ich von deren Live-Qualitäten. Gerade in der Heimat sind die diesbezüglich ja eine Macht, hier sind sie mehr ein (Achtung, Wortspiel mit Band-Song) „Underdog“. Aber man arbeitet dran, spielt ein solides Set an „Hits“ aus den ersten drei Alben und Frontmann Tom Meighan übt sich als Crowd-Anheizer mit dem gewissen Mix aus Lausbuben-Image und Arroganz. Nützt aber nix. Der Sound ist mies und das Publikum ist eher damit beschäftigt, den Bierpegel in die Höhe zu treiben. Neue Zielgruppen erschließt man hier sicher schwer. Aber solange sich unter den knapp 50.000 Leuten eine Handvoll Interessierter und potentieller Käufer findet, hat sich das Ganze ja schon gelohnt. Ein lukrativer Sommerjob halt für mittelgroße Bands. Und das hat sich ja rumgesprochen. Fragen sie mal Snow Patrol oder Interpol.
Dann heißt es wieder weiter warten. Und der Innenraum füllt sich dann doch langsam aber sicher. Leider mit dem Publikum, das man angesichts einer Band, die ihr Debütalbum vor dreißig Jahren veröffentlicht hat, durchaus erwarten kann. Aber ich meine, mit 26 bewege ich mich ja auch langsam in diese Bereiche vor. Leider trennt sich da einiges und meist hat man das Gefühl, die Spreu bleibt übrig. Und für die Damen und Herren ist ein U2-Konzert in erster Linie natürlich ein Event. Willkommene Abwechslung vom Alltag. Sicher, man mag auch die Band und die alten Platten und so, aber Hauptsache es ist mal wieder was los in der Stadt. Fehlt ja nur eine Plane und Kralle wäre ein tolles Zirkuszelt. Na ja, also werden viele T-Shirts gekauft oder selbergedruckt und sich vor allem reichlich mit Bier eingedeckt. Die ganze Zeit! Und in Massen. Der finanzielle Tourausfall-Verlust wird weg gesoffen! Und so sind alle lustig drauf, fotografieren sich immer wieder vor der Kralle oder einem Ordner oder und stimmen lustige „Wir wollen den Bono sehen“-Sprechchöre an. Die gelungene Abwechslung vom Büroalltag ist ja auch jedem zu gönnen. Festivals sind eh nicht mehr in deren Zielgruppenbereich und ja sowieso viel zu kompliziert, schmutzig und aufwendig. Also fokussiert sich dies gern mal auf einzelne Events alter Helden. Depeche Mode sind auch so Favoriten, das hab ich letztes Jahr gemerkt. Ironischerweise läuft auch „Enjoy The Silence“ in der Aufwärmphase. Ein Raunen geht durch die Menschen. Der Rest der Musik entpuppt sich als überraschend tagesaktueller Mix aus feinsten Indie-Perlen, aber da hat jemand eindeutig an der Zielgruppe vorbeioperiert. Aber zumindest hatte er gute Ambitionen. Na ja, erstmal ein Bier. Und noch eines. 5 Euro für nen halben Liter? O zapft is! Einige haben zu Konzertbeginn anscheinend schon genug. Die Fremdschämquote steigt ein wenig. Ein Hoch auf meine, ebenfalls anwesenden und anständigen Eltern! Ich bleibe bei einem „Ich kann mich auch ohne Alkohol amüsieren“ und komme dann mal zur Hauptband des Abends. Die gab’s ja auch noch.
 Kurz vor 21 Uhr betraten die vier viel umjubelten Iren zu den Klängen von David Bowie’s „Space Oddity“ die Bühne und lassen sich erstmal ordentlich vom Hannover Publikum feiern. Als Intro fungiert ein neues Instrumental-Stück. Ja, The Edge war während Bonos Reha durchaus produktiv. Es folgt „Beautiful Day“, eine fast schon zu sichere Wahl für den ersten Song. Der Zirkus beginnt, Manege frei für die Megastars. Es folgt relativ wenig vom aktuellen Album „No Line On The Horizon“, weil… ja, warum eigentlich? U2 gehen auf Nummer sicher und liefern ein paar gute Evergreens. Und so hat man während Songs wie „New Years Day“, „Mysterious Ways“ oder „Elevation“ Zeit sich mit der Bühne und ihren positiven, wie negativen Eigenarten auseinanderzusetzen. Das Spiel „Such den Bono“ wird mal eben ruckzuck zum Publikumsrenner, denn die Möglichkeit, sich entweder auf der Bühne oder per Brückenüberquerung auch auf dem Außenkreis zu bewegen nutzen alle Bandmitglieder. Die Brücken bewegen sich übrigens auch noch. Das führt natürlich zu feinen Momenten, wenn Bono auf einmal in gerade mal zwei Meter Entfernung über einem steht und „Hallo“ sagt. Da wird selbst ein mittelmäßiger Song wie „City Of Blinding Lights“ zum Erlebnis. Das Publikum wendet seine Gesichter, egal, ob Bono, The Edge oder Adam Clayton, immer Richtung Rockstar. Und natürlich wird da alles an iPhones, Fotohandys und Digi-Cams gezückt, was das Inventar zu bieten hat. Also hält man permanent die Augen auf. Wie ein Paparazzi sucht man das beste Motiv und die Nähe zum Star. Das führt dann aber auch gern mal zu frustrierenden Momenten, wenn Bono zum Beispiel beim 84er Klassiker „The Unforgettable Fire“ gar nicht zu erspähen ist. Die Konzertsozialisierung der letzten Jahrzehnte nötig jeden, den Fixpunkt Bono zu suchen, aber er ist halt einfach nicht da. Dabei ist The Edge ja auch noch da. Und generell… sollte es nicht um die Musik gehen? Na ja, etwas Show muss auch sein. Und “etwas” ist in diesem Fall halt viiiiel Technik. Allein bei der Vorstellung darüber, wie teuer die ausklappbare LCD-Wand gekostet hat, wird mir schlecht. Ich versuche die existenten, gleichzeitg herum reisenden drei (!) Krallen, ihre Produktions- und Transportkosten auszurechen und das in Relation mit… sagen wir mal, humanitärer Hilfe für Afrika (Wunder Punkt, Herr Vox) zu setzen… aber beim Rechnen wird mir schlecht. Ich bleibe bei ungläubigem Kopfschütteln. Hätte etwas weniger nicht auch den gleichen Effekt gehabt? Das Herumlaufen der Protagonisten wirkt nicht nur extrem einstudiert, sondern entpuppt sich auch eher als Gimmick. Die Höhe der Bühne dürfte für Genickstarre der Personen vorne sorgen und generell… das Anliegen, das alle mehr sehen können ist eher eine Lüge. Vielmehr lassen sich dadurch noch ein paar billige Plätze hinter der Bühne verkaufen. Ein Schelm, der böses dabei denkt. Die Kartenkäufer dürften sich freuen, denn prinzipiell ist die Kralle immer noch eine klassische Bühne, halt mit offener Rückwand und nem etwas längeren Rundum-Steg. Die Band agiert aber einen Großteil des Konzertes nach vorn gewandt. Immerhin steht die Bühne ja auch nicht in der Mitte des Stadions. Der Effekt besteht in der Größe, die jeden Normalbürger erschlägt und im Showkonzept, bei dem die Band sich gern mal als Insassen ihres riesigen Raumschiffes präsentiert. Bonos Roboteransprache wirkt da sogar relativ witzig. Ansonsten liefert der gute Mann die Show, die man von ihm erwartet. Etwas schreien, etwas gestikulieren und vor allem viel trinken. Hat der Doktor wohl gesagt. Ansonsten animiert Bono halt auch viel zum mitsingen, was sich natürlich bei Stadion-Allzweckwaffen, wie „I Still Haven’t Found What I’m Looking For“ als todsicheres Mittel entpuppt, um zum einen Gänsehaut zu erzeugen und zum anderen, den letzten Stillsitzer zu motivieren. Bonos Stimme macht einen guten Eindruck. Sie klingt sowieso schon lange nicht mehr wie 1991 und die Tagesform spielt mittlerweile leider eine entscheidende Rolle (Negativ: siehe die letzten beiden Live-DVDs).
Kurz vor 21 Uhr betraten die vier viel umjubelten Iren zu den Klängen von David Bowie’s „Space Oddity“ die Bühne und lassen sich erstmal ordentlich vom Hannover Publikum feiern. Als Intro fungiert ein neues Instrumental-Stück. Ja, The Edge war während Bonos Reha durchaus produktiv. Es folgt „Beautiful Day“, eine fast schon zu sichere Wahl für den ersten Song. Der Zirkus beginnt, Manege frei für die Megastars. Es folgt relativ wenig vom aktuellen Album „No Line On The Horizon“, weil… ja, warum eigentlich? U2 gehen auf Nummer sicher und liefern ein paar gute Evergreens. Und so hat man während Songs wie „New Years Day“, „Mysterious Ways“ oder „Elevation“ Zeit sich mit der Bühne und ihren positiven, wie negativen Eigenarten auseinanderzusetzen. Das Spiel „Such den Bono“ wird mal eben ruckzuck zum Publikumsrenner, denn die Möglichkeit, sich entweder auf der Bühne oder per Brückenüberquerung auch auf dem Außenkreis zu bewegen nutzen alle Bandmitglieder. Die Brücken bewegen sich übrigens auch noch. Das führt natürlich zu feinen Momenten, wenn Bono auf einmal in gerade mal zwei Meter Entfernung über einem steht und „Hallo“ sagt. Da wird selbst ein mittelmäßiger Song wie „City Of Blinding Lights“ zum Erlebnis. Das Publikum wendet seine Gesichter, egal, ob Bono, The Edge oder Adam Clayton, immer Richtung Rockstar. Und natürlich wird da alles an iPhones, Fotohandys und Digi-Cams gezückt, was das Inventar zu bieten hat. Also hält man permanent die Augen auf. Wie ein Paparazzi sucht man das beste Motiv und die Nähe zum Star. Das führt dann aber auch gern mal zu frustrierenden Momenten, wenn Bono zum Beispiel beim 84er Klassiker „The Unforgettable Fire“ gar nicht zu erspähen ist. Die Konzertsozialisierung der letzten Jahrzehnte nötig jeden, den Fixpunkt Bono zu suchen, aber er ist halt einfach nicht da. Dabei ist The Edge ja auch noch da. Und generell… sollte es nicht um die Musik gehen? Na ja, etwas Show muss auch sein. Und “etwas” ist in diesem Fall halt viiiiel Technik. Allein bei der Vorstellung darüber, wie teuer die ausklappbare LCD-Wand gekostet hat, wird mir schlecht. Ich versuche die existenten, gleichzeitg herum reisenden drei (!) Krallen, ihre Produktions- und Transportkosten auszurechen und das in Relation mit… sagen wir mal, humanitärer Hilfe für Afrika (Wunder Punkt, Herr Vox) zu setzen… aber beim Rechnen wird mir schlecht. Ich bleibe bei ungläubigem Kopfschütteln. Hätte etwas weniger nicht auch den gleichen Effekt gehabt? Das Herumlaufen der Protagonisten wirkt nicht nur extrem einstudiert, sondern entpuppt sich auch eher als Gimmick. Die Höhe der Bühne dürfte für Genickstarre der Personen vorne sorgen und generell… das Anliegen, das alle mehr sehen können ist eher eine Lüge. Vielmehr lassen sich dadurch noch ein paar billige Plätze hinter der Bühne verkaufen. Ein Schelm, der böses dabei denkt. Die Kartenkäufer dürften sich freuen, denn prinzipiell ist die Kralle immer noch eine klassische Bühne, halt mit offener Rückwand und nem etwas längeren Rundum-Steg. Die Band agiert aber einen Großteil des Konzertes nach vorn gewandt. Immerhin steht die Bühne ja auch nicht in der Mitte des Stadions. Der Effekt besteht in der Größe, die jeden Normalbürger erschlägt und im Showkonzept, bei dem die Band sich gern mal als Insassen ihres riesigen Raumschiffes präsentiert. Bonos Roboteransprache wirkt da sogar relativ witzig. Ansonsten liefert der gute Mann die Show, die man von ihm erwartet. Etwas schreien, etwas gestikulieren und vor allem viel trinken. Hat der Doktor wohl gesagt. Ansonsten animiert Bono halt auch viel zum mitsingen, was sich natürlich bei Stadion-Allzweckwaffen, wie „I Still Haven’t Found What I’m Looking For“ als todsicheres Mittel entpuppt, um zum einen Gänsehaut zu erzeugen und zum anderen, den letzten Stillsitzer zu motivieren. Bonos Stimme macht einen guten Eindruck. Sie klingt sowieso schon lange nicht mehr wie 1991 und die Tagesform spielt mittlerweile leider eine entscheidende Rolle (Negativ: siehe die letzten beiden Live-DVDs).  An diesem Abend klappt alles und das sorgt gelegentlich für tolle Momente, etwa wenn man mal kurz das Singles-Gerüst verlässt und einen ganz neuen Track, wie das krachige „Glastonbury“ spielt. Oder der zehn Jahre alte Album-Track „In A Little While“. Richtig schön wird es bei „Miss Sarajevo“, dem Song, der einst für das Seitenprojekt „Passangers“ mit Brian Eno, Mitte der 90er, entstand. Die traurige Ballade vom Schönheitswettbewerb im kriegsgebeutelten Sarajevo der 90er wird sehr reduziert vorgetragen. Die Stimme von Duettpartner Luciano Pavarotti ist mittlerweile leider für immer verstummt, aber Bono singt den Opern-Part auf magische Weise einfach selber und erzeugt phänomenalen Jubel. Ein großer Moment, auf den Punkt genau funktionierend. Vielleicht der schönste des ganzen Abends und das Argument, was für „Yes, Bono!“ als Überschrift spricht. Denn U2 haben in ihrer Karriere großartige Songs geschrieben. Sicher, die Hits wurden tot gespielt, wenngleich sie ja im Prinzip immer noch gute Songs sind. Aber auch abseits davon haben U2 Brillantes geschaffen. Deshalb halte ich ihnen auch die Treue, wenngleich die letzten zehn Jahre nicht mehr sooo viel von dieser Brillanz zeigen, wie frühere Taten. Aber nach drei Jahrzehnten noch auf diesem Level zu spielen und sich dabei musikalisch immer wieder selbst zu puschen… da gehört schon Einiges dazu. Und diese Band spielt immer noch im Original Line-Up. Da sind vier Freunde auf der Bühne, das merkt man. Selbst wenn sie an diesem Abend eher Pflichterfüllung betreiben und es Bono sichtlich schwer fällt, die Leute beim schnittigen, aber etwas fremdartig wirkenden, Dance-Teil zu „I’ll Go Crazy If I Don’t Go Crazy Tonight“ zum Ausflippen zu bringen. Wer wedelt mit den Armen, aber kommt nicht gegen den eigenen Schatten aus Hits und der Erwartungshaltung des Publikums an. Schade eigentlich.
An diesem Abend klappt alles und das sorgt gelegentlich für tolle Momente, etwa wenn man mal kurz das Singles-Gerüst verlässt und einen ganz neuen Track, wie das krachige „Glastonbury“ spielt. Oder der zehn Jahre alte Album-Track „In A Little While“. Richtig schön wird es bei „Miss Sarajevo“, dem Song, der einst für das Seitenprojekt „Passangers“ mit Brian Eno, Mitte der 90er, entstand. Die traurige Ballade vom Schönheitswettbewerb im kriegsgebeutelten Sarajevo der 90er wird sehr reduziert vorgetragen. Die Stimme von Duettpartner Luciano Pavarotti ist mittlerweile leider für immer verstummt, aber Bono singt den Opern-Part auf magische Weise einfach selber und erzeugt phänomenalen Jubel. Ein großer Moment, auf den Punkt genau funktionierend. Vielleicht der schönste des ganzen Abends und das Argument, was für „Yes, Bono!“ als Überschrift spricht. Denn U2 haben in ihrer Karriere großartige Songs geschrieben. Sicher, die Hits wurden tot gespielt, wenngleich sie ja im Prinzip immer noch gute Songs sind. Aber auch abseits davon haben U2 Brillantes geschaffen. Deshalb halte ich ihnen auch die Treue, wenngleich die letzten zehn Jahre nicht mehr sooo viel von dieser Brillanz zeigen, wie frühere Taten. Aber nach drei Jahrzehnten noch auf diesem Level zu spielen und sich dabei musikalisch immer wieder selbst zu puschen… da gehört schon Einiges dazu. Und diese Band spielt immer noch im Original Line-Up. Da sind vier Freunde auf der Bühne, das merkt man. Selbst wenn sie an diesem Abend eher Pflichterfüllung betreiben und es Bono sichtlich schwer fällt, die Leute beim schnittigen, aber etwas fremdartig wirkenden, Dance-Teil zu „I’ll Go Crazy If I Don’t Go Crazy Tonight“ zum Ausflippen zu bringen. Wer wedelt mit den Armen, aber kommt nicht gegen den eigenen Schatten aus Hits und der Erwartungshaltung des Publikums an. Schade eigentlich. Schade auch deshalb, weil die Band selber ja noch einigermaßen fit in der Birne ist und musikalisch noch vieles erreichen möchte. Immerhin sind laut Bono gerade drei Alben-Konzepte in der Entwicklung. Mal sehen, wieviel davon am Ende übrig bleibt. Aber aufs Altenteil kann und will man sich wohl noch nicht zurückziehen, was sehr vorbildlich ist. Live hinterlässt das Ganze dann doch irgendwie einen etwas uneuphorischen Beigeschmack. Je größer die Show und die Technik dahinter, desto durchgeplanter und auch irgendwie seelenloser wirkt das Ganze. Selbst Bono beschreibt das Ganze irgendwie passenderweise als ein Volksfest mit hoher Bierquote. Das Spektakel steht im Vorder-, die Musik im Hintergrund. Sicher, wenn dann bei „With Or Without You“ mal die Ehefrau kurz in den Arm genommen wird, ist das schon anrührend, bleibt aber nur eine Momentaufnahme. Showbiz pur, da wirken selbst die obligatorischen politischen Einsprenkler ein wenig fehl am Platz. Seit jeher ein Streitthema, anscheinend auch unter den Fans. Als zwischen den Zugaben eine Rede von Desmond Tutu über die Leinwand flimmert, in dem er die Leute weiterhin zum Kampf gegen die Armut in Afrika ermuntert, gibt es auch vereinzelte Pfiffe, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob die jetzt aus Begeisterung entstanden sind. Für das schlechte Gewissen ist kein Platz beim Volksfest. Gejubelt wird beim anschließenden "One" aber dennoch. Nett sind diese Momente aber trotzdem. Und wichtig! Was macht denn eigentlich die Revolutionsbewegung in Theheran? Hätte Bono ja mal besseres Update geben können. Das abschließende "Moment Of Surrender" dann noch Robert Enke zu widmen (inkl. Larry Mullen Jr. im "Hannover-96"-Trikot) ist ebenfalls höchst ehrbar und
Schade auch deshalb, weil die Band selber ja noch einigermaßen fit in der Birne ist und musikalisch noch vieles erreichen möchte. Immerhin sind laut Bono gerade drei Alben-Konzepte in der Entwicklung. Mal sehen, wieviel davon am Ende übrig bleibt. Aber aufs Altenteil kann und will man sich wohl noch nicht zurückziehen, was sehr vorbildlich ist. Live hinterlässt das Ganze dann doch irgendwie einen etwas uneuphorischen Beigeschmack. Je größer die Show und die Technik dahinter, desto durchgeplanter und auch irgendwie seelenloser wirkt das Ganze. Selbst Bono beschreibt das Ganze irgendwie passenderweise als ein Volksfest mit hoher Bierquote. Das Spektakel steht im Vorder-, die Musik im Hintergrund. Sicher, wenn dann bei „With Or Without You“ mal die Ehefrau kurz in den Arm genommen wird, ist das schon anrührend, bleibt aber nur eine Momentaufnahme. Showbiz pur, da wirken selbst die obligatorischen politischen Einsprenkler ein wenig fehl am Platz. Seit jeher ein Streitthema, anscheinend auch unter den Fans. Als zwischen den Zugaben eine Rede von Desmond Tutu über die Leinwand flimmert, in dem er die Leute weiterhin zum Kampf gegen die Armut in Afrika ermuntert, gibt es auch vereinzelte Pfiffe, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob die jetzt aus Begeisterung entstanden sind. Für das schlechte Gewissen ist kein Platz beim Volksfest. Gejubelt wird beim anschließenden "One" aber dennoch. Nett sind diese Momente aber trotzdem. Und wichtig! Was macht denn eigentlich die Revolutionsbewegung in Theheran? Hätte Bono ja mal besseres Update geben können. Das abschließende "Moment Of Surrender" dann noch Robert Enke zu widmen (inkl. Larry Mullen Jr. im "Hannover-96"-Trikot) ist ebenfalls höchst ehrbar undscheint die Menschen eher zu bewegen, als Amnestys Alltagssorgen oder das Schicksal von Freiheitskämpferin Aung San Suu Kyi in Burma. Aber für seine politischen Botschaften bieten die Shows für Bono die gleiche lukrative Möglichkeit, wie der Sommerjob von Kasabian und Co. ... Wenn schon ein paar Dutzend Menschen sich Gedanken machen, ihre Unterschrift geben und Umdenken, dann ist das schon ein Erfolg. Da muss man sich kleine Maßstäbe setzen. Aber ich möchte hier nicht alles schlecht reden, denn diese Show bot auch sehr viel Gutes. Mehr gutes, als schlechtes. Die Schauwerte sind beeindruckend, besonders wenn man sie richtig einsetzt. So z.B. bei "Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me" aus dem Jahr 1995, bei dem die einstige "Coolness"
der Band nochmal durchblitzt. Düster, Experimentell und irgendwie mit subtiler Erotik untersetzt... dass diese Anti-Hymne damals das erste Stück Musik war, dass ich je von U2 gehört habe, hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Irgendwo zwischen Zoo TV und PopMart entstanden, also zur Hochphase, als U2 ihr Gigantomanie-Konzept auch künstlerisch einfach mal auf die Spitze getrieben haben, inkl. Kostümen und Kunstfiguren. Von MacPhisto ist
mittlerweile nur noch ein bisschen reflektierendes Rotlicht in Bonos Spiegeljacke geblieben. Die wilden Zeiten sind vorbei. Irgendwie traurig, aber der Lauf des Lebens. Schätz ich mal.
Am Ende gehen die Lichter an, der Jubel ist groß und die Band verschwindet wieder in den Katakomben des Stadions. Wer noch kein Foto vor der Kralle gemacht hat, tut dies jetzt. Ein weiteres Bier wird angesichts des Andrangs schwer werden. Nach der Show ist vor der Show. U2 ziehen weiter durch die Welt, die nächste Bühne wird ja schon anderorts aufgebaut. Und das Fazit? Nein, das ist jetzt nicht total vernichtend, aber auch kein euphorisches "Yes, Bono!" U2 sind und bleiben eine großartige Band. Um sich das immer wieder zu bestätigen muss man nur mal deren musikalisches Schaffen in den letzten 30 Jahren betrachten und all die musikalischen Genres, die sie da abgegrast haben. Absolute Beständigkeit und Hitquote. Aber das bringt halt nach so langer
Zeit an der Weltspitze auch einige Schattenseiten mit sich. Sinkende Risikobereitschaft (Setlist) und akuter Größenwahn (Bühne) sowieso. Das raubt den eigentlich sehr tollen Songs ein wenig die Seele und das Gefühl, zumal diese Faktoren bei manchen auch gar nicht wichtig zu sein scheinen. Es war schön, die einstigen Helden nochmal live und vor allem relativ nahe gesehen zu haben. Und vermutlich sollte ich auch nicht so naiv sein und hier mehr erwarten, als dies der Fall ist. Konzerte in dieser Größenordnung sind Events mit zig anderen Faktoren und Nebenerscheinungen. Das ist schon in Ordnung so. Jeder nach seiner Farcon. Meine ist's auf Dauer jedenfalls nicht. Vielleicht denken ja dann selbst die irischen Volkshelden nochmal um, und versuchen sich nicht auf Teufel komm raus, immer wieder selbst zu toppen. Da ist die Obergrenzen nämlich irgendwie auch langsam
erreicht. Selbst beim Größenwahn gilt: weniger ist manchmal eben doch mehr. Dann wird das vielleicht nochmal was mit der Überschrift.
Setlist:
01 Return of the Stingray Guitar
02 Beautiful Day
03 New Year's Day
04 Get On Your Boots
05 Magnificent
06 Mysterious Ways
07 Elevation
08 I Still Haven't Found What I'm Looking For
09 Glastonbury
10 In A Little While
11 Miss Sarajevo
12 Until the End of the World
13 The Unforgettable Fire
14 City of Blinding Lights
15 Vertigo
16 I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight (Remix)/ Discotheque
17 Sunday Bloody Sunday
18 MLK
19 Walk On
20 One
21 Where the Streets Have No Name
22 Hold Me Thrill Me Kiss Me Kill Me
23 With or Without You
24 Moment of Surrender
rhododendron - 14. Aug, 09:59

 Jede Band hat in ihrem Leben einen kreativen Höhepunkt bzw. Zenit. Ihn zu erreichen ist ganz natürlich, ihn hinter sich zu lassen ebenso. Bei manchen dauert er länger, bei anderen gerade mal einen Song oder so. Der perfekte Moment, in dem alles gelingt und alles scheinbar leicht erscheint. Im Falle von Nada Surf ist es ein Album und zwar „Let Go“ aus dem Jahr 2002. Irgendwelche Gegenargumente? Die Mehrheit im Beatpol hätte mir gestern zugestimmt. Ich habe zumindest mehr Leute mit einem frisch am Merchstand gekauften Exemplar des 8 Jahre alten Meisterwerks gesehen, als mit einer Ausgabe des jüngst erschienenen, allerdings recht durchschnittlichen Coveralbums „If I Had A Hi-Fi“ gesehen. Die Publikumsreaktionen bei den „Hits“ dieses Indie-Kleinods sind ebenfalls eindeutig. Die Band macht aus der Not eine Tugend und lässt den Songs von „Let Go“ immerhin ein Drittel der Setliste Platz. Man ist sich der Stärke bewusst, spielt sie auch und das ist ja auch gut so. Will man ja auch so hören. Und es wäre natürlich der Band gegenüber nicht fair, das alles nur auf eine Platte zu schieben, denn auch der 2005er Nachfolger „The Weight Is A Gift“ hatte noch einige wirklich gute und große Momente, sogar „Lucky“ aus dem Jahr 2008. Mit zwei Songs aus diesem Album, „Weightless“ und „Whose Authority“ beginnt die Band kurz nach 10 ihr Set und wirkt so entspannt und lässig, wie eh und je. Gut, außer Elliot, welcher hinter seinem Schlagzeug gern mal etwas miesepetrig darein schaut. Ein vierter Mitmusiker wurde sich von Calexico ausgeborgt. Und die Trompete stand natürlich erwartungsgemäß hinter ihm bereit. Dann spielen Nada Surf erstmals die „Let-Go“-Karte aus und bei „Happy Kid“ geht ein leichtes Raunen durch den Raum. Die darauffolgenden Songs „Inside Of Love“ und „Fruit Fly“ von selbiger Platte tun dann ihr Übriges. Doch warum funktioniert das immer noch so gut? „Let Go“ hat nicht nur die richtigen Songs, sondern auch die passende Atmosphäre. Sie strahlt ein hohes Maß an Lässigkeit, aber auch Melancholie aus. Das Zweifeln am Leben wird genauso bedacht, wie die Freude daran. Es thematisiert die allgemeine Unsicherheit und das Suchen und Finden im Leben. Das funktioniert mit 16 genauso, wie mit 46. Das thematisiert Caws ja auch auf anderen Songs, aber nirgends passte das so zusammen, wie auf diesem Werk. Und das wird auch nie wieder so funktionieren, was auch in Ordnung ist. Aber das dieses Album Leben retten kann, steht außer Frage. Ich denke, dass Publikum wird mir zustimmen. Deshalb will man diese Songs auch hören und die Band will sie auch spielen. Das Coveralbum war eher eine spaßige Nebensache, die jetzt als Anlass dient, mal wieder auf Tour zu gehen. Und die Tatsache, dass lediglich vier Songs aus dem Album gespielt werden, zeigt das ja auch. Immerhin ist das Depeche-Mode-Cover von „Enjoy The Silence“ richtig gelungen und „Love And Anger“ von Kate Bush ist ein wirklich toller Popsong, der auch bei Nada Surf funktioniert, eben weil sie sich dicht als Original halten. Und im Falle des Go-Between-Covers „Love Goes On“ passt das ja auch, weil die Nummer von Natur aus eh schon wie eine Nada-Surf-Eigenkomposition klingt. Aber diese Songs tendieren halt überhört zu werden, immerhin hat die Band zu viel tolle eigene Lieder dabei. Das tolle „80 Windows“ wird dank Trompete noch mal ordentlich aufgearbeitet, beim unkaputtbaren „Blonde On Blonde“ haben selbst hart gesottene Männer die ein oder andere Träne im Knopfloch und „Hi-Speed Soul“ klingt immer noch so unnachahmlich catchy, wie vor Jahren. Konservierte Glückseeligkeit! Nada Surf sind die Zeremonienmeister im Zirkus der Zärtlichkeiten, erlauben sich auch das ein oder andere Lob ans Dresdner Publikum bzw. diverse Scherze über die nicht angestrahlte Discokugel im Raum. Mit ihr hätte das doch eine gewisse Abschlusstanz-Atmosphäre gehabt, was ja durchaus im ewig jugendlichen Sinne der Band gewesen wäre.
Jede Band hat in ihrem Leben einen kreativen Höhepunkt bzw. Zenit. Ihn zu erreichen ist ganz natürlich, ihn hinter sich zu lassen ebenso. Bei manchen dauert er länger, bei anderen gerade mal einen Song oder so. Der perfekte Moment, in dem alles gelingt und alles scheinbar leicht erscheint. Im Falle von Nada Surf ist es ein Album und zwar „Let Go“ aus dem Jahr 2002. Irgendwelche Gegenargumente? Die Mehrheit im Beatpol hätte mir gestern zugestimmt. Ich habe zumindest mehr Leute mit einem frisch am Merchstand gekauften Exemplar des 8 Jahre alten Meisterwerks gesehen, als mit einer Ausgabe des jüngst erschienenen, allerdings recht durchschnittlichen Coveralbums „If I Had A Hi-Fi“ gesehen. Die Publikumsreaktionen bei den „Hits“ dieses Indie-Kleinods sind ebenfalls eindeutig. Die Band macht aus der Not eine Tugend und lässt den Songs von „Let Go“ immerhin ein Drittel der Setliste Platz. Man ist sich der Stärke bewusst, spielt sie auch und das ist ja auch gut so. Will man ja auch so hören. Und es wäre natürlich der Band gegenüber nicht fair, das alles nur auf eine Platte zu schieben, denn auch der 2005er Nachfolger „The Weight Is A Gift“ hatte noch einige wirklich gute und große Momente, sogar „Lucky“ aus dem Jahr 2008. Mit zwei Songs aus diesem Album, „Weightless“ und „Whose Authority“ beginnt die Band kurz nach 10 ihr Set und wirkt so entspannt und lässig, wie eh und je. Gut, außer Elliot, welcher hinter seinem Schlagzeug gern mal etwas miesepetrig darein schaut. Ein vierter Mitmusiker wurde sich von Calexico ausgeborgt. Und die Trompete stand natürlich erwartungsgemäß hinter ihm bereit. Dann spielen Nada Surf erstmals die „Let-Go“-Karte aus und bei „Happy Kid“ geht ein leichtes Raunen durch den Raum. Die darauffolgenden Songs „Inside Of Love“ und „Fruit Fly“ von selbiger Platte tun dann ihr Übriges. Doch warum funktioniert das immer noch so gut? „Let Go“ hat nicht nur die richtigen Songs, sondern auch die passende Atmosphäre. Sie strahlt ein hohes Maß an Lässigkeit, aber auch Melancholie aus. Das Zweifeln am Leben wird genauso bedacht, wie die Freude daran. Es thematisiert die allgemeine Unsicherheit und das Suchen und Finden im Leben. Das funktioniert mit 16 genauso, wie mit 46. Das thematisiert Caws ja auch auf anderen Songs, aber nirgends passte das so zusammen, wie auf diesem Werk. Und das wird auch nie wieder so funktionieren, was auch in Ordnung ist. Aber das dieses Album Leben retten kann, steht außer Frage. Ich denke, dass Publikum wird mir zustimmen. Deshalb will man diese Songs auch hören und die Band will sie auch spielen. Das Coveralbum war eher eine spaßige Nebensache, die jetzt als Anlass dient, mal wieder auf Tour zu gehen. Und die Tatsache, dass lediglich vier Songs aus dem Album gespielt werden, zeigt das ja auch. Immerhin ist das Depeche-Mode-Cover von „Enjoy The Silence“ richtig gelungen und „Love And Anger“ von Kate Bush ist ein wirklich toller Popsong, der auch bei Nada Surf funktioniert, eben weil sie sich dicht als Original halten. Und im Falle des Go-Between-Covers „Love Goes On“ passt das ja auch, weil die Nummer von Natur aus eh schon wie eine Nada-Surf-Eigenkomposition klingt. Aber diese Songs tendieren halt überhört zu werden, immerhin hat die Band zu viel tolle eigene Lieder dabei. Das tolle „80 Windows“ wird dank Trompete noch mal ordentlich aufgearbeitet, beim unkaputtbaren „Blonde On Blonde“ haben selbst hart gesottene Männer die ein oder andere Träne im Knopfloch und „Hi-Speed Soul“ klingt immer noch so unnachahmlich catchy, wie vor Jahren. Konservierte Glückseeligkeit! Nada Surf sind die Zeremonienmeister im Zirkus der Zärtlichkeiten, erlauben sich auch das ein oder andere Lob ans Dresdner Publikum bzw. diverse Scherze über die nicht angestrahlte Discokugel im Raum. Mit ihr hätte das doch eine gewisse Abschlusstanz-Atmosphäre gehabt, was ja durchaus im ewig jugendlichen Sinne der Band gewesen wäre.
 Auf der Hauptbühne fingen danach die wiedervereinigten Skunk Anansie an. Mir stellten sich da primär zwei Fragen: „Wer hat die vermisst?“ und „Hatten die außer ‚Hedonism’ noch einen zweiten Hit?“ Anscheinend ja, aber trotz Aufwachsens in den 90ern überließ ich die Band um Frontfrau Skin da mal lieber dem restlichen Publikum, denen das ganze aber sichtlich gefiel. Und um das 90er-Feeling dennoch ordentlich aufkommen zu lassen, gab ich mir natürlich als krönenden Abschluss des Abends die unverwüstlichen Rave-Altmeister von The Prodigy. Was ein Fest! What you expect is what you get. Ich meine, seinen wir mal ehrlich: The Prodigy machen keine gute Musik und zerren primär von der Vergangenheit und ihrer Hochphase von 1994 bis 1997. Daran ändert auch das aktuelle Album „Invaders Must Die“ nichts. Der dritte Frühling, den die Band damit ausgelöst hat, funktioniert nur, weil sie sich da hervorragend selber kopieren und es das allgemeine Rave-Revival gerade zulässt. Aber ansonsten funktioniert die Prodigy-Maschine nach dem ewig gleichen, wenn auch effektiven Prinzip: Uffe Zwölf! Dicke Beats, laute Gitarren und Bässe und die ewig hängengebliebenen Front-MCs Maxim Reality und Keith Flint, welche natürlich die ewig gleichen Phrasen in die Mikros grölen. Viel „Fuck“ ist dabei und Mr. Reality fragt sehr häufig, wo denn seine „people“ nun sind. Vor deiner Nase natürlich! Das Publikum ist laut, euphorisiert und feiert dabei natürlich „Firestarter“, „Breathe“, „Voodoo People“, aber auch neue Tracks, wie „Omen“ oder „Take Me To The Hospital“. Hauptsache es bollert! Und das tut es ja auch. Und deshalb will ich die Band auch nicht schlechter reden, als sie ist. Das System funktioniert und unterhält blendend. Mein durchgeschwitztes T-Shirt sei mein Zeuge! Wenngleich mich nach gut einer Stunde langsam die Kräfte verlassen und man merkt, dass die Band darüber hinaus anfängt, mit ihrem Sound ein wenig zu langweilen. Ein Highlight war’s ohnehin! Party like it’s 1996! Den Rest ersparte ich mir in dieser Nacht, zu müde war ich.
Auf der Hauptbühne fingen danach die wiedervereinigten Skunk Anansie an. Mir stellten sich da primär zwei Fragen: „Wer hat die vermisst?“ und „Hatten die außer ‚Hedonism’ noch einen zweiten Hit?“ Anscheinend ja, aber trotz Aufwachsens in den 90ern überließ ich die Band um Frontfrau Skin da mal lieber dem restlichen Publikum, denen das ganze aber sichtlich gefiel. Und um das 90er-Feeling dennoch ordentlich aufkommen zu lassen, gab ich mir natürlich als krönenden Abschluss des Abends die unverwüstlichen Rave-Altmeister von The Prodigy. Was ein Fest! What you expect is what you get. Ich meine, seinen wir mal ehrlich: The Prodigy machen keine gute Musik und zerren primär von der Vergangenheit und ihrer Hochphase von 1994 bis 1997. Daran ändert auch das aktuelle Album „Invaders Must Die“ nichts. Der dritte Frühling, den die Band damit ausgelöst hat, funktioniert nur, weil sie sich da hervorragend selber kopieren und es das allgemeine Rave-Revival gerade zulässt. Aber ansonsten funktioniert die Prodigy-Maschine nach dem ewig gleichen, wenn auch effektiven Prinzip: Uffe Zwölf! Dicke Beats, laute Gitarren und Bässe und die ewig hängengebliebenen Front-MCs Maxim Reality und Keith Flint, welche natürlich die ewig gleichen Phrasen in die Mikros grölen. Viel „Fuck“ ist dabei und Mr. Reality fragt sehr häufig, wo denn seine „people“ nun sind. Vor deiner Nase natürlich! Das Publikum ist laut, euphorisiert und feiert dabei natürlich „Firestarter“, „Breathe“, „Voodoo People“, aber auch neue Tracks, wie „Omen“ oder „Take Me To The Hospital“. Hauptsache es bollert! Und das tut es ja auch. Und deshalb will ich die Band auch nicht schlechter reden, als sie ist. Das System funktioniert und unterhält blendend. Mein durchgeschwitztes T-Shirt sei mein Zeuge! Wenngleich mich nach gut einer Stunde langsam die Kräfte verlassen und man merkt, dass die Band darüber hinaus anfängt, mit ihrem Sound ein wenig zu langweilen. Ein Highlight war’s ohnehin! Party like it’s 1996! Den Rest ersparte ich mir in dieser Nacht, zu müde war ich. Der Montag war dann wieder erwartungsgemäß heiß, lies es musikalisch aber etwas ruhiger angehen. Immerhin hatte man dann etwas Zeit, sich mal Hradec Králové anzuschauen. Urlaub muss sein! Irgendwann am späten Nachmittag spielten dann Disco Ensemble aus Finnland, aber die hatten auch nur eine Songidee auf Lager. Und das war keine gute! Es folgte auf der Hauptbühne der ehemalige Dead-Kennedys-Frontmann Jello Biafra, der etwas später auftauchte, als geplant. Seine Band und er waren wohl im falschen tschechischen Ort gelandet, hieß es. Der lustige alte Mann wirkte dann ein wenig, wie die Punk-Ausgabe eines Morrissey. Mit viel Gesten, viel Mikrofonkabel und allerhand lustigem Small-Talk. Natürlich über die böse Politik und das doofe Amerika. Und die bösen Kommerz- und Ausbeuterfirmen halt. Wobei ich nicht wissen möchte, von wem der gute Mann sein Equipment hat. Na ja, wenn die Leute, die sagen, Punk sei nicht tot, noch einen Beweis dafür brauchen… Biafra gibt ihn! Zeit für noch ein Bier. Vermutlich hatte Jello auch was gegen das schöne Wetter, es folgte das unvermeidliche Hitzegewitter mit fettem Platzregen. Pünktlich dann, als das große Anstellen vor der Hauptbühne angesichts des Hauptacts Muse begann. Vor enterte noch die blaugefärbte Juliette Lewis die Bühne und tat das, was sie am Besten konnte. Grimassenschneiden, Cool rocken, schreien und sich ordentlich verrenken. Das hob die Stimmung dann nach dem Regen doch ein wenig. Bleibt schon ne coole Rock-Lady, die gute Frau. Aber auch nur Zwischenstation auf dem Weg zum eigentlich Tageshighlight: Muse! Laut eigenen Aussagen hat es das Festival etwas Glück (ein Termin der Band ist aufgefallen) und viel Geld gekostet die Stadionrocker (hartes Urteil, aber das ist mittlerweile leider die Realität) aus dem Vereinigten Königreich zu bekommen.
Der Montag war dann wieder erwartungsgemäß heiß, lies es musikalisch aber etwas ruhiger angehen. Immerhin hatte man dann etwas Zeit, sich mal Hradec Králové anzuschauen. Urlaub muss sein! Irgendwann am späten Nachmittag spielten dann Disco Ensemble aus Finnland, aber die hatten auch nur eine Songidee auf Lager. Und das war keine gute! Es folgte auf der Hauptbühne der ehemalige Dead-Kennedys-Frontmann Jello Biafra, der etwas später auftauchte, als geplant. Seine Band und er waren wohl im falschen tschechischen Ort gelandet, hieß es. Der lustige alte Mann wirkte dann ein wenig, wie die Punk-Ausgabe eines Morrissey. Mit viel Gesten, viel Mikrofonkabel und allerhand lustigem Small-Talk. Natürlich über die böse Politik und das doofe Amerika. Und die bösen Kommerz- und Ausbeuterfirmen halt. Wobei ich nicht wissen möchte, von wem der gute Mann sein Equipment hat. Na ja, wenn die Leute, die sagen, Punk sei nicht tot, noch einen Beweis dafür brauchen… Biafra gibt ihn! Zeit für noch ein Bier. Vermutlich hatte Jello auch was gegen das schöne Wetter, es folgte das unvermeidliche Hitzegewitter mit fettem Platzregen. Pünktlich dann, als das große Anstellen vor der Hauptbühne angesichts des Hauptacts Muse begann. Vor enterte noch die blaugefärbte Juliette Lewis die Bühne und tat das, was sie am Besten konnte. Grimassenschneiden, Cool rocken, schreien und sich ordentlich verrenken. Das hob die Stimmung dann nach dem Regen doch ein wenig. Bleibt schon ne coole Rock-Lady, die gute Frau. Aber auch nur Zwischenstation auf dem Weg zum eigentlich Tageshighlight: Muse! Laut eigenen Aussagen hat es das Festival etwas Glück (ein Termin der Band ist aufgefallen) und viel Geld gekostet die Stadionrocker (hartes Urteil, aber das ist mittlerweile leider die Realität) aus dem Vereinigten Königreich zu bekommen.  Aber das Geld ist in jedem Fall gut angelegt, denn Muse sind und bleiben die vielleicht beste Live-Band der Welt. Millionen Fans können nicht irren, so auch an diesem Abend, als sich die Band durch ein fast anderthalbstündiges Set ihrer aktuellen „Ressistance“-Tour spielt. Das gestaltet sich erwartungsgemäß überraschungsarm, liefert aber dafür die erwarteten Hits. Immerhin wird gleich mit „Uprising“, „Supermassive Black Hole“ und „New Born“ eröffnet. Für die alten Fans gibt’s wenigstens noch „Citizen Erased“ vom 2001er „Origin Of Symmetry“. Außerdem jede Menge Interludes, bei denen Matthew Bellamy und Kollegen ihrem Hang zu gutem handfesten Gitarrenrock frönen. Und immerhin erspart man uns den „Twilight“-Song. Dafür spart man nicht an Bühnenshow, viel Licht und jede Menge Lasern, sowie großen Gesten. Das sieht toll aus und reißt auch anständig mit. Aber das machen solche Songmonster, wie bspw. der Abschluss „Knights Of Cydonia“ ja sowieso. Dennoch wirkt das alles ein wenig zu glatt und eingespielt. Muse scheinen Opfer jener Krankheit zu werden, die alle großen Bands befällt… eine gewisse Überraschungsarmut und Überprofessionalität. Na ja, wollen wir mal nicht das Haar in der Suppe suchen. Die Show war trotzdem astrein. Einen wunderschönen Abschluss für den Tag bescherten mir dann die formidablen Archive, welche auf der Zweitbühne einen spannenden Mix aus Progrock, Trip-Hop, Elektronik und schöner Lichtshow boten. Sehr stimmungsvolle, abwechslungsreiche Tracks des Musikerkollektives. Ein wenig wie eine weniger anstrengende Variante von Radiohead, möchte man meinen. Vielleicht eine Band, mit der ich mich jetzt endlich mal näher auseinandersetzen sollte.
Aber das Geld ist in jedem Fall gut angelegt, denn Muse sind und bleiben die vielleicht beste Live-Band der Welt. Millionen Fans können nicht irren, so auch an diesem Abend, als sich die Band durch ein fast anderthalbstündiges Set ihrer aktuellen „Ressistance“-Tour spielt. Das gestaltet sich erwartungsgemäß überraschungsarm, liefert aber dafür die erwarteten Hits. Immerhin wird gleich mit „Uprising“, „Supermassive Black Hole“ und „New Born“ eröffnet. Für die alten Fans gibt’s wenigstens noch „Citizen Erased“ vom 2001er „Origin Of Symmetry“. Außerdem jede Menge Interludes, bei denen Matthew Bellamy und Kollegen ihrem Hang zu gutem handfesten Gitarrenrock frönen. Und immerhin erspart man uns den „Twilight“-Song. Dafür spart man nicht an Bühnenshow, viel Licht und jede Menge Lasern, sowie großen Gesten. Das sieht toll aus und reißt auch anständig mit. Aber das machen solche Songmonster, wie bspw. der Abschluss „Knights Of Cydonia“ ja sowieso. Dennoch wirkt das alles ein wenig zu glatt und eingespielt. Muse scheinen Opfer jener Krankheit zu werden, die alle großen Bands befällt… eine gewisse Überraschungsarmut und Überprofessionalität. Na ja, wollen wir mal nicht das Haar in der Suppe suchen. Die Show war trotzdem astrein. Einen wunderschönen Abschluss für den Tag bescherten mir dann die formidablen Archive, welche auf der Zweitbühne einen spannenden Mix aus Progrock, Trip-Hop, Elektronik und schöner Lichtshow boten. Sehr stimmungsvolle, abwechslungsreiche Tracks des Musikerkollektives. Ein wenig wie eine weniger anstrengende Variante von Radiohead, möchte man meinen. Vielleicht eine Band, mit der ich mich jetzt endlich mal näher auseinandersetzen sollte. Der finale Tag war dann ein wenig bewölkter und bot auch etwas mehr Regen. Blieb man einfach etwas länger im Zelt. Pünktlich zu den britischen Hardcore-Rockern Gallows hörte der dann aber auch auf. Die stark tätowierten Jungs um den charismatischen Frank Carter hätte das sowieso nicht aufgehalten. Und obwohl ich mit dieser Musik im Alltag sicher wenig anfangen kann, so kann ich mir eine gewisse Wertschätzung gegenüber der Band nicht verkneifen. Das, was sie machen, machen sie sehr gut. Ihre Wut wirkt ehrlich und authentisch… selbst wenn sie sich gegen das noch etwas träge Publikum wendet. Man schreit, man treibt. So muss Punk vermutlich sein. Wäre ich ein junger, frustrierter, britischer Teenager wäre das meine Band! So bin ich aber ein halbwegs zufriedene Mitzwanziger, der sich an diesem Nachmittag lieber der kleineren Bühne widmete. Dort standen nun die Krawallbrüder von Does It Offend You, Yeah? auf dem Programm, deren explosiver Elektrorock mich bereits 2008 auf dem MELT! begeisterte. Mittlerweile hat man die Band ein wenig umgestellt, beherrscht die eigenen Instrumente etwas besser und hat ein neues Album in den Startlöchern. Ansonsten alles beim Alten. Die lieblichen Pop-Songs, welche das Debüt stellenweise noch hatte will man dabei sogar gänzlich weglassen. Dafür soll es noch lauter und basslastiger werden. Hauptsache direkt in die Fresse! Nichts anderes passiert natürlich hier. Bratziger Elektro-Rock, ständiger Auf- und Abbau und Frontmann James Rushent, welcher das Publikum immer wieder an den Eiern packt und es so Stück für Stück zum mitmachen zwingt. Erfolg einkalkuliert. DIOYY? fahren ein ähnlich idiotensicheres Konzept, wie The Prodigy, wirken dabei halt nur etwas frischer und unverbrauchter. Sicher für jedes Festival ein Glücksgriff. Auch diesmal bestätigt sich der Ruf als kurzweilige Live-Band. Den haben ja bekanntermaßen auch The Subways, welche anschließend an der Reihe sind. Das Rock-Trio gibt dem Publikum, was es erwartet und dieses dankt es mit bedingungslosem Stimmungsmachen. Zieht anscheinend weltweit, nur nach wie vor nicht bei mir. Ich halte die Subways immer noch für eine der überflüssigsten Bands des Planeten. Überraschungsarmer Standardrock ohne jegliche neue Idee. Ständig nach dem gleichen Muster aufgebaut. Die einzige Funktion der Songs ist es, das Publikum, mit einem knackigen Refrain (darf auch gern simpel gehalten werden) zum Mitgröhlen- und Moschen zu bewegen. Einstudiert wirkende Gesten und belanglose Texte gehören auch dazu. Ja, wem das Spaß macht, der soll ihn haben, ich find die Band einfach furchtbar belanglos.
Der finale Tag war dann ein wenig bewölkter und bot auch etwas mehr Regen. Blieb man einfach etwas länger im Zelt. Pünktlich zu den britischen Hardcore-Rockern Gallows hörte der dann aber auch auf. Die stark tätowierten Jungs um den charismatischen Frank Carter hätte das sowieso nicht aufgehalten. Und obwohl ich mit dieser Musik im Alltag sicher wenig anfangen kann, so kann ich mir eine gewisse Wertschätzung gegenüber der Band nicht verkneifen. Das, was sie machen, machen sie sehr gut. Ihre Wut wirkt ehrlich und authentisch… selbst wenn sie sich gegen das noch etwas träge Publikum wendet. Man schreit, man treibt. So muss Punk vermutlich sein. Wäre ich ein junger, frustrierter, britischer Teenager wäre das meine Band! So bin ich aber ein halbwegs zufriedene Mitzwanziger, der sich an diesem Nachmittag lieber der kleineren Bühne widmete. Dort standen nun die Krawallbrüder von Does It Offend You, Yeah? auf dem Programm, deren explosiver Elektrorock mich bereits 2008 auf dem MELT! begeisterte. Mittlerweile hat man die Band ein wenig umgestellt, beherrscht die eigenen Instrumente etwas besser und hat ein neues Album in den Startlöchern. Ansonsten alles beim Alten. Die lieblichen Pop-Songs, welche das Debüt stellenweise noch hatte will man dabei sogar gänzlich weglassen. Dafür soll es noch lauter und basslastiger werden. Hauptsache direkt in die Fresse! Nichts anderes passiert natürlich hier. Bratziger Elektro-Rock, ständiger Auf- und Abbau und Frontmann James Rushent, welcher das Publikum immer wieder an den Eiern packt und es so Stück für Stück zum mitmachen zwingt. Erfolg einkalkuliert. DIOYY? fahren ein ähnlich idiotensicheres Konzept, wie The Prodigy, wirken dabei halt nur etwas frischer und unverbrauchter. Sicher für jedes Festival ein Glücksgriff. Auch diesmal bestätigt sich der Ruf als kurzweilige Live-Band. Den haben ja bekanntermaßen auch The Subways, welche anschließend an der Reihe sind. Das Rock-Trio gibt dem Publikum, was es erwartet und dieses dankt es mit bedingungslosem Stimmungsmachen. Zieht anscheinend weltweit, nur nach wie vor nicht bei mir. Ich halte die Subways immer noch für eine der überflüssigsten Bands des Planeten. Überraschungsarmer Standardrock ohne jegliche neue Idee. Ständig nach dem gleichen Muster aufgebaut. Die einzige Funktion der Songs ist es, das Publikum, mit einem knackigen Refrain (darf auch gern simpel gehalten werden) zum Mitgröhlen- und Moschen zu bewegen. Einstudiert wirkende Gesten und belanglose Texte gehören auch dazu. Ja, wem das Spaß macht, der soll ihn haben, ich find die Band einfach furchtbar belanglos.  Na ja, gute Miene zum bösen Spiel, immerhin kommen danach die Editors und da will man sich ja einen guten Platz sichern. Ehrlicherweise muss ich aber eingestehen, dass mir da vielleicht auch beim mittlerweile siebten Auftritt, den ich von dieser Band miterleben durfte, die Kritikfähigkeit abhanden gekommen ist. Gut sind die natürlich immer, weil ihre Songs stimmen und Tom Smith einfach mal ein optischer Magnet ist. Auch an diesem Tag wieder gut gekleidet und mit Sex Appeal vollgestopft! Das Set ist dabei eine ebenfalls recht überraschungsarme Ansammlung an Singles, die man kennt und liebt. „Bullets“ darf dabei genauso wenig fehlen, wie „Racing Rats“, „Eat Raw Meat“ oder die Krankenhaus-Raucher. Fan-Geschenke sollte man da ja auch nicht erwarten. Immerhin haben die Editors aber den besseren Twilight-Song, als Muse. Gespielt wird er trotzdem nicht. Das Set endet mit einem gewohnt schmissigen „Papillon“ und es tut gut, die Band mal wieder gesehen zu haben. Das Publikum war ebenfalls gut drauf, hielt sich in Sachen Ekstase aber etwas zurück. Muss ja auch nicht immer. Damit waren die persönlichen Highlights zufrieden stellend abgegrast und alles andere war nur Bonus. Das Genießen des Geländes mitsamt den kulinarischen Köstlichkeiten bspw. Auf Billy Talent und NOFX verzichte ich gern. Wer brauch die schon, wenn man Kryštof haben kann? Wer? Ja, Tschechiens anscheinend bekanntester Rock- und Popstar (so hab ich’s mir zumindest erzählen lassen) spielte auch noch und es war schön, aus einiger Entfernung zu sehen, wie er seine Landsleute mit schmissigen und durchaus kurzweiligen Popsongs unterhielt. Ein lustiger, langhaariger Mann mit Akkustikgitarre, der durch alle Altersschichten zu begeistern scheint. Warum auch nicht?
Na ja, gute Miene zum bösen Spiel, immerhin kommen danach die Editors und da will man sich ja einen guten Platz sichern. Ehrlicherweise muss ich aber eingestehen, dass mir da vielleicht auch beim mittlerweile siebten Auftritt, den ich von dieser Band miterleben durfte, die Kritikfähigkeit abhanden gekommen ist. Gut sind die natürlich immer, weil ihre Songs stimmen und Tom Smith einfach mal ein optischer Magnet ist. Auch an diesem Tag wieder gut gekleidet und mit Sex Appeal vollgestopft! Das Set ist dabei eine ebenfalls recht überraschungsarme Ansammlung an Singles, die man kennt und liebt. „Bullets“ darf dabei genauso wenig fehlen, wie „Racing Rats“, „Eat Raw Meat“ oder die Krankenhaus-Raucher. Fan-Geschenke sollte man da ja auch nicht erwarten. Immerhin haben die Editors aber den besseren Twilight-Song, als Muse. Gespielt wird er trotzdem nicht. Das Set endet mit einem gewohnt schmissigen „Papillon“ und es tut gut, die Band mal wieder gesehen zu haben. Das Publikum war ebenfalls gut drauf, hielt sich in Sachen Ekstase aber etwas zurück. Muss ja auch nicht immer. Damit waren die persönlichen Highlights zufrieden stellend abgegrast und alles andere war nur Bonus. Das Genießen des Geländes mitsamt den kulinarischen Köstlichkeiten bspw. Auf Billy Talent und NOFX verzichte ich gern. Wer brauch die schon, wenn man Kryštof haben kann? Wer? Ja, Tschechiens anscheinend bekanntester Rock- und Popstar (so hab ich’s mir zumindest erzählen lassen) spielte auch noch und es war schön, aus einiger Entfernung zu sehen, wie er seine Landsleute mit schmissigen und durchaus kurzweiligen Popsongs unterhielt. Ein lustiger, langhaariger Mann mit Akkustikgitarre, der durch alle Altersschichten zu begeistern scheint. Warum auch nicht? 
 Natürlich, wie sich das, für eine gerade so extrem gehypte Kombo gehört, wird der Postbahnhof deshalb an diesem Abend von jede Menge Berliner Hipstern und solchen, die es werden wollen heimgesucht. Von angehenden Abiturientinnen bis zu alten Haudegen mit grauen Schläfen ist da alles vorhanden, was man einer solchen Band ja schon einmal hoch anrechnen muss, immerhin erscheint das Album offiziell ja erst diesen Freitag und vorher geleakt war es meines Wissens an diesem Abend auch noch nicht. Die Hits kennt man trotzdem, weil sich die Band ja in den letzten Monaten im Internet gut herumgesprochen hat. Dabei ist das ja alles keinesfalls, wie an diversen Orten behauptet wird, die größte Erfindung seit der Mikrowelle oder den Strokes, sondern recht gewöhnlicher Indie-Poprock, der sich seine Versatzstücke aus der Geschichte klaut. Etwas Smiths hier, etwas Cure da und natürlich halt auch die Beach Boys, Surfen hin oder her! Aber in der Retrokiste kann man ja gern wühlen. Und das R-Wort haben sich die Drums ja ohnehin auf die Fahne geschrieben. Egal, ob Sound, Videos, Fotos oder klamottentechnisches Erscheinungsbild… hier gilt alles nach 1987 als notorisches Feindbild, so scheint es. Aber vielleicht ist es gerade diese bewusste Abneigung gegen ein modernes Erscheinungsbild, welche die Band so interessant hat. Egal, ob Kalkül oder Kunst- es erweckt Aufmerksamkeit, denn die Hütte war schon gut gefüllt. Nach einer verzichtbaren Berliner Indie-Rock-Band namens „Use Your Fucking Headphones“ (nicht weil die jetzt so schlecht waren, sondern weil ich all diese Versatzstücke in den letzten fünf Jahren schon ca. 400 Mal an anderer Stelle gehört habe und sich mein Kopf da weigert, Interesse dran zu zeigen) ließen sich die Herren Drums dann etwas Zeit und betrachten nach einer unnötig langen Umbaupause mit unnötig viel Michael-Jackson-Songs gegen 22.15 Uhr die Bühne und boten dem Publikum eine extrem kurzweilige Show.
Natürlich, wie sich das, für eine gerade so extrem gehypte Kombo gehört, wird der Postbahnhof deshalb an diesem Abend von jede Menge Berliner Hipstern und solchen, die es werden wollen heimgesucht. Von angehenden Abiturientinnen bis zu alten Haudegen mit grauen Schläfen ist da alles vorhanden, was man einer solchen Band ja schon einmal hoch anrechnen muss, immerhin erscheint das Album offiziell ja erst diesen Freitag und vorher geleakt war es meines Wissens an diesem Abend auch noch nicht. Die Hits kennt man trotzdem, weil sich die Band ja in den letzten Monaten im Internet gut herumgesprochen hat. Dabei ist das ja alles keinesfalls, wie an diversen Orten behauptet wird, die größte Erfindung seit der Mikrowelle oder den Strokes, sondern recht gewöhnlicher Indie-Poprock, der sich seine Versatzstücke aus der Geschichte klaut. Etwas Smiths hier, etwas Cure da und natürlich halt auch die Beach Boys, Surfen hin oder her! Aber in der Retrokiste kann man ja gern wühlen. Und das R-Wort haben sich die Drums ja ohnehin auf die Fahne geschrieben. Egal, ob Sound, Videos, Fotos oder klamottentechnisches Erscheinungsbild… hier gilt alles nach 1987 als notorisches Feindbild, so scheint es. Aber vielleicht ist es gerade diese bewusste Abneigung gegen ein modernes Erscheinungsbild, welche die Band so interessant hat. Egal, ob Kalkül oder Kunst- es erweckt Aufmerksamkeit, denn die Hütte war schon gut gefüllt. Nach einer verzichtbaren Berliner Indie-Rock-Band namens „Use Your Fucking Headphones“ (nicht weil die jetzt so schlecht waren, sondern weil ich all diese Versatzstücke in den letzten fünf Jahren schon ca. 400 Mal an anderer Stelle gehört habe und sich mein Kopf da weigert, Interesse dran zu zeigen) ließen sich die Herren Drums dann etwas Zeit und betrachten nach einer unnötig langen Umbaupause mit unnötig viel Michael-Jackson-Songs gegen 22.15 Uhr die Bühne und boten dem Publikum eine extrem kurzweilige Show. Und „Film“ ist da ein gutes Stichwort, denn die Show ordnet sich einer kleinen filmischen Rahmenhandlung unter, die mit dem Albumintro „Nausea“ beginnt und die dort erzählte Geschichte des kleinen Mädchens, welches bei einem Waldspaziergang über eine seltsam geformte Wurzel stolpert weiterspinnt und das Albumkonzept so mit surrealen Bildern von Landschaften, Menschen und sehr gern auch mal Tieren untermalt. Und jenem Mädchen, das munter weiter erzählt von ihren Träumen, Ängsten und anderen seltsamen Anwandlungen. Zusammen mit dem Sound von „Vexations“ ergibt sich ein wunderbares Gesamtbild, das audiovisuell zu begeistern scheint, auch weil Get Well Soon das Albumkonzept fast lückenlos durchziehen. Gut, es finden sich noch „People Magazine Front Cover“ vom Debüt, sowie die Weihnachtssingle „Listen! Those Lost At Sea Sing A Song On Christmas Day“ im Set, aber ansonsten werden die Unannehmlichkeiten des Albums recht konsequent durchgezogen. Alle Songs, mal mit Ausnahme des kurzen Instrumentalstücks „We Are Still“ werden auch in der exakt gleichen Reihenfolge (also, falls ich mich nicht verhört habe) wiedergegeben und entfalten live, obwohl sie meist 1:1 wie auf Platte gespielt werden, ungeahnte Kräfte. Ein Freudenfest in Sachen Melancholie. Songs wie „We Are Free“ oder „A Voice In The Louvre“ entfalten in ihrer nachdenklichen Verzweiflung auch oft das Gefühl von Befreiung. Eine sehr seltsame Kombination, aber kurz zusammengefasst muss man einfach erkennen, dass diese Musik wahnsinnig gut gemacht ist. Hochgradig musikalisch, ehrlich, authentisch und gelegentlich sogar ein wenig eingängig. Wie bspw. das relativ lockere „Werner Herzog Gets Shot“, das hier etwas reduzierter vorgetragen wird. Ansonsten verweigern sich Gropper und seine Mitmusiker selten der Opulenz und es ist beeindruckend, wie voll der Klang trotz der Anwesenheit von „nur“ 6 Musikern wirklich ist, wenngleich da natürlich ein paar Elemente, wie die Waldhörner auch vom Band kommen, denn für den Gebirgsjägerverein war dann doch kein Platz mehr auf der Bühne. Und bei „We Are Ghosts“ übernimmt die Band am Ende sogar selber die Rolle der Geister und singt den Refrain von der Leinwand aus, während sie sich in real die Seele aus dem Leib spielen. Doch ist nicht nur die Schwere, die begeistert, es sind auch die ruhigen Momente, die bewegen. Etwa der langsame Schleicher „That Love“ vom neuen Album oder die sich zwischendurch ins Set mogelnde Version von „Tick Tack! Goes My Automatic Heart“, die den Höhepunkt des Abends darstellt und die Show für einige Minuten in Sphären bringt, die man nicht anders als mit dem Wort „Perfektion“ bezeichnen kann. Als Konstantin das Stück akustisch nur mit stimmlicher Unterstützung von Schwester Verena beginnt, hören auch langsam die letzten Menschen im Raum mit Small Talk und Bierflaschen-Geklapper auf. Als dann die Band einsteigt wird’s episch, während man sich für das Ende noch einmal zurücknimmt und die Geschwister Gropper noch einmal abseits des Mikrofons ganz intim weitersingen. Und auch das Publikum macht zögerlich mit. Ein magischer Musikmoment an dessen Ende ein frenetischer Jubel steht, der außergewöhnlich lang und herzlich ausfällt. Gropper sagt brav und ehrlich „Danke“, lächelt fein, hält sich aber ansonsten zurück mit Ansagen. Unser Glück, wie er später angesichts seines selber als eher schlecht eingeschätzten Wortwitzes, feststellt. Aber immerhin wurde das Büfett gelobt. Ist ja auch etwas. Nach drei weiteren Stücken endet der Film mit dem düsteren Nachhallen von „We Are The Roman Empire“ und einem anständigen Abspann am auf der Leinwand an dessen Ende auch dem Publikum gedankt wird. Der Film ist vorbei. Und die Moral von der Geschicht? „Change Your Life“ ruft uns die Protagonistin des Märchens noch in die Dunkelheit. Es sind manchmal die einfachsten Phrasen, die hängen bleiben.
Und „Film“ ist da ein gutes Stichwort, denn die Show ordnet sich einer kleinen filmischen Rahmenhandlung unter, die mit dem Albumintro „Nausea“ beginnt und die dort erzählte Geschichte des kleinen Mädchens, welches bei einem Waldspaziergang über eine seltsam geformte Wurzel stolpert weiterspinnt und das Albumkonzept so mit surrealen Bildern von Landschaften, Menschen und sehr gern auch mal Tieren untermalt. Und jenem Mädchen, das munter weiter erzählt von ihren Träumen, Ängsten und anderen seltsamen Anwandlungen. Zusammen mit dem Sound von „Vexations“ ergibt sich ein wunderbares Gesamtbild, das audiovisuell zu begeistern scheint, auch weil Get Well Soon das Albumkonzept fast lückenlos durchziehen. Gut, es finden sich noch „People Magazine Front Cover“ vom Debüt, sowie die Weihnachtssingle „Listen! Those Lost At Sea Sing A Song On Christmas Day“ im Set, aber ansonsten werden die Unannehmlichkeiten des Albums recht konsequent durchgezogen. Alle Songs, mal mit Ausnahme des kurzen Instrumentalstücks „We Are Still“ werden auch in der exakt gleichen Reihenfolge (also, falls ich mich nicht verhört habe) wiedergegeben und entfalten live, obwohl sie meist 1:1 wie auf Platte gespielt werden, ungeahnte Kräfte. Ein Freudenfest in Sachen Melancholie. Songs wie „We Are Free“ oder „A Voice In The Louvre“ entfalten in ihrer nachdenklichen Verzweiflung auch oft das Gefühl von Befreiung. Eine sehr seltsame Kombination, aber kurz zusammengefasst muss man einfach erkennen, dass diese Musik wahnsinnig gut gemacht ist. Hochgradig musikalisch, ehrlich, authentisch und gelegentlich sogar ein wenig eingängig. Wie bspw. das relativ lockere „Werner Herzog Gets Shot“, das hier etwas reduzierter vorgetragen wird. Ansonsten verweigern sich Gropper und seine Mitmusiker selten der Opulenz und es ist beeindruckend, wie voll der Klang trotz der Anwesenheit von „nur“ 6 Musikern wirklich ist, wenngleich da natürlich ein paar Elemente, wie die Waldhörner auch vom Band kommen, denn für den Gebirgsjägerverein war dann doch kein Platz mehr auf der Bühne. Und bei „We Are Ghosts“ übernimmt die Band am Ende sogar selber die Rolle der Geister und singt den Refrain von der Leinwand aus, während sie sich in real die Seele aus dem Leib spielen. Doch ist nicht nur die Schwere, die begeistert, es sind auch die ruhigen Momente, die bewegen. Etwa der langsame Schleicher „That Love“ vom neuen Album oder die sich zwischendurch ins Set mogelnde Version von „Tick Tack! Goes My Automatic Heart“, die den Höhepunkt des Abends darstellt und die Show für einige Minuten in Sphären bringt, die man nicht anders als mit dem Wort „Perfektion“ bezeichnen kann. Als Konstantin das Stück akustisch nur mit stimmlicher Unterstützung von Schwester Verena beginnt, hören auch langsam die letzten Menschen im Raum mit Small Talk und Bierflaschen-Geklapper auf. Als dann die Band einsteigt wird’s episch, während man sich für das Ende noch einmal zurücknimmt und die Geschwister Gropper noch einmal abseits des Mikrofons ganz intim weitersingen. Und auch das Publikum macht zögerlich mit. Ein magischer Musikmoment an dessen Ende ein frenetischer Jubel steht, der außergewöhnlich lang und herzlich ausfällt. Gropper sagt brav und ehrlich „Danke“, lächelt fein, hält sich aber ansonsten zurück mit Ansagen. Unser Glück, wie er später angesichts seines selber als eher schlecht eingeschätzten Wortwitzes, feststellt. Aber immerhin wurde das Büfett gelobt. Ist ja auch etwas. Nach drei weiteren Stücken endet der Film mit dem düsteren Nachhallen von „We Are The Roman Empire“ und einem anständigen Abspann am auf der Leinwand an dessen Ende auch dem Publikum gedankt wird. Der Film ist vorbei. Und die Moral von der Geschicht? „Change Your Life“ ruft uns die Protagonistin des Märchens noch in die Dunkelheit. Es sind manchmal die einfachsten Phrasen, die hängen bleiben. Ausverkauft war der kleine Club im Brückenpfeiler dabei schon seit einigen Wochen, weshalb sich davor auch eine imposante Meute an Menschen wieder fand, die dennoch auf Tickets hoffte. Hier hätte man sein 9,50 Euro Kärtchen sicher zu einem guten Preis losbekommen. Aber nützt nichts, wir wollten halt die Band sehen. Der Bang Bang Club war dann auch dementsprechend recht ordentlich gefüllt. Jede weitere Person hätte vermutlich die Kapazitäten gesprengt. Auf eine Vorband verzichtete man glücklicherweise auch und das Trio entpuppte sich als pünktlich, so dass es kurz nach 22 Uhr dann endlich losgehen konnte. Vorbei war der Auftritt übrigens schon wieder kurz vor 11. In der knappen Stunde dazwischen spielte, fitzelte und ravete sich die Band durch die Stücke ihres Debüts, leider mit Ausnahme des schönen Albumclosers „Remain“. Warum eigentlich, Delphic? Der Rest vom Fest groovte aber ordentlich und ließ selten eine Pause zwischen zum Applaudieren zwischen den Stücken. Wie eine Art Live-DJ-Set lässt die Band gern mal die Stücke nahtlos ineinander übergehen und stellt diese damit ganz in den Dienst des Dancefloors. Von der aktuellen Single „Doubt“ geht’s bspw. direkt hinüber zur nächsten, „Halcyon“. „Submission“ drosselt dann ein wenig das Tempo und lässt der guten alten Gitarre mal den Vortritt, während „Red Lights“ die Beats wieder etwas mehr pumpen lässt und dabei vor allem auf leichte Trance-Elemente setzt. Das Set gleicht einem trancendalen Flug, untermalt von Beats, pumpenden Basslinien, Sequenzer- und Synthieflächen. Die Texte von bedeutungsschwanger bis bedeutungslos wirken eher wie die klassischen Dancefloor-Lyrics… „Give me something I could believe in“, „Let’s do something real“ und so weiter und sofort. Das Mitsingen gerät eher zur Nebensache, Hauptsache die Musik bleibt immer in Bewegung, immer im Rausch. Allein „This Momentary“ wird auf gefühlte 10 Minuten ausgebaut, auch „Counterpoint“ gewinnt noch mal an Länge. Und der abschließende Titeltrack von „Acolyte“ hat das sowieso nicht nötig, denn der ist ja bekanntermaßen schon fast 9 Minuten lang. Die Grenzen und Strukturen zerfließen, Delphic verfestigen ihren Ruf, Elemente der Dance- und Indiemusik zu gleichen Anteilen miteinander zu verschmelzen. Der groovende Beweis dafür, dass sich Rave und Hymne nicht ausschließen. Die Referenzen, seien es New Order oder die Chemical Brothers werden ja von der Musikpresse eh mittlerweile munter durch den Raum geworfen. Live sind die Hands-Up-Rave-Momente eindeutig zu spüren. Gerade deshalb ist es ein wenig verwunderlich und schade, dass sich das Berliner Publikum der Soundekstase zu großen Teilen zu verweigern scheint. Fast wirkt es so, als kommt man zur vorsichtigen und noch zögerlichen Besichtigung dieser neuen Kapelle. Als ob man mal schauen wollte, was denn das ist, über das der NME und seine Kollegen so viel schreibt. Pauschalisieren möchte ich zwar nicht, denn vereinzelt werden Teile des Publikums mitgerissen, aber hier wäre doch Potential im Bang Bang Club gewesen, es der guten alten Hacienda gleichzutun und sich ganz dem Sound hinzugeben. An der Musik lag es jedenfalls nicht. Aber Spaß ist ja bekanntlich was man selber draus macht und so versuchte ich für mich zumindest ein Optimum aus der ganzen Sache herauszuholen und die individuelle Schweißquote nach oben zu treiben.
Ausverkauft war der kleine Club im Brückenpfeiler dabei schon seit einigen Wochen, weshalb sich davor auch eine imposante Meute an Menschen wieder fand, die dennoch auf Tickets hoffte. Hier hätte man sein 9,50 Euro Kärtchen sicher zu einem guten Preis losbekommen. Aber nützt nichts, wir wollten halt die Band sehen. Der Bang Bang Club war dann auch dementsprechend recht ordentlich gefüllt. Jede weitere Person hätte vermutlich die Kapazitäten gesprengt. Auf eine Vorband verzichtete man glücklicherweise auch und das Trio entpuppte sich als pünktlich, so dass es kurz nach 22 Uhr dann endlich losgehen konnte. Vorbei war der Auftritt übrigens schon wieder kurz vor 11. In der knappen Stunde dazwischen spielte, fitzelte und ravete sich die Band durch die Stücke ihres Debüts, leider mit Ausnahme des schönen Albumclosers „Remain“. Warum eigentlich, Delphic? Der Rest vom Fest groovte aber ordentlich und ließ selten eine Pause zwischen zum Applaudieren zwischen den Stücken. Wie eine Art Live-DJ-Set lässt die Band gern mal die Stücke nahtlos ineinander übergehen und stellt diese damit ganz in den Dienst des Dancefloors. Von der aktuellen Single „Doubt“ geht’s bspw. direkt hinüber zur nächsten, „Halcyon“. „Submission“ drosselt dann ein wenig das Tempo und lässt der guten alten Gitarre mal den Vortritt, während „Red Lights“ die Beats wieder etwas mehr pumpen lässt und dabei vor allem auf leichte Trance-Elemente setzt. Das Set gleicht einem trancendalen Flug, untermalt von Beats, pumpenden Basslinien, Sequenzer- und Synthieflächen. Die Texte von bedeutungsschwanger bis bedeutungslos wirken eher wie die klassischen Dancefloor-Lyrics… „Give me something I could believe in“, „Let’s do something real“ und so weiter und sofort. Das Mitsingen gerät eher zur Nebensache, Hauptsache die Musik bleibt immer in Bewegung, immer im Rausch. Allein „This Momentary“ wird auf gefühlte 10 Minuten ausgebaut, auch „Counterpoint“ gewinnt noch mal an Länge. Und der abschließende Titeltrack von „Acolyte“ hat das sowieso nicht nötig, denn der ist ja bekanntermaßen schon fast 9 Minuten lang. Die Grenzen und Strukturen zerfließen, Delphic verfestigen ihren Ruf, Elemente der Dance- und Indiemusik zu gleichen Anteilen miteinander zu verschmelzen. Der groovende Beweis dafür, dass sich Rave und Hymne nicht ausschließen. Die Referenzen, seien es New Order oder die Chemical Brothers werden ja von der Musikpresse eh mittlerweile munter durch den Raum geworfen. Live sind die Hands-Up-Rave-Momente eindeutig zu spüren. Gerade deshalb ist es ein wenig verwunderlich und schade, dass sich das Berliner Publikum der Soundekstase zu großen Teilen zu verweigern scheint. Fast wirkt es so, als kommt man zur vorsichtigen und noch zögerlichen Besichtigung dieser neuen Kapelle. Als ob man mal schauen wollte, was denn das ist, über das der NME und seine Kollegen so viel schreibt. Pauschalisieren möchte ich zwar nicht, denn vereinzelt werden Teile des Publikums mitgerissen, aber hier wäre doch Potential im Bang Bang Club gewesen, es der guten alten Hacienda gleichzutun und sich ganz dem Sound hinzugeben. An der Musik lag es jedenfalls nicht. Aber Spaß ist ja bekanntlich was man selber draus macht und so versuchte ich für mich zumindest ein Optimum aus der ganzen Sache herauszuholen und die individuelle Schweißquote nach oben zu treiben.  r: Wenn man die fulminante „Pandemonium“-Show des britischen Popduos bereits im Sommer gesehen hat, so wie wir zwei, dann ist die Wintertour natürlich erstaunlich überraschungsarm. Ich empfehle deshalb auch die Lektüre meiner Leipzig-Rezension im Juni. Die Show bleibt natürlich so toll, wie sie bereits beim ersten Mal war, mit dem schönen Unterschied, dass ich diesmal weiter vorn stand und das Ganze endlich auch mal wirklich sehen konnte. Ansonsten sind die Würfel immer noch das zentrale Element. Sie bauen sich auf, sie stürzen wieder ein, hängen an Schnüren oder werden von den Tänzern als Wurfgeschosse benutzt. Dazu gibt’s jede Menge Kostüme, Hintergrundvideos und Tanzeinlagen. Muss ja auch, da Tennant und Lowe das Gegenkonzept von Rampensäuen sind. Die geben sich weiterhin als gut gekleidete Gentleman des Elektropop und pfeffern fast die exakt gleiche Setlist aus dem Sommer um unsere Ohren, die sich aber nach wie vor sehr gut anhört. Natürlich sind da die Gassenhauer wie „Suburbia“, „It’s A Sin“ und „Always On My Mind“ dabei, die man schon nicht mehr hören kann, aber live durchaus Sinn machen. Auch „Go West“, welches glücklicherweise immer noch über die Beats von „Paninaro“ gelegt wird. Und dann sind da natürlich ein paar Mahsups, sowie das famose Oldschool-Special mit „Two Divided By Zero“ und „Why Don’t We Live Together?“ vom Debütalbum „Please“, welche beweisen, dass die Boys tatsächlich mal richtig cool klangen. Ansonsten gesellen sich das schnittige „New York City Boy“, sowie die Allzweckwaffe „What Have I Done To Deserve This?“ ins Programm. Nett, aber nicht weltbewegend. Glücklicherweise sorgen die Boys mit Musical Conductor Stuart Price immer wieder dafür, dass die Show nicht zu einer totalen Greatest-Hits-Revue verkommt. So gibt es die tolle 80er B-Seite „Do I Have To?“, welche nahtlos in das wunderbare „King’s Cross“ überläuft und zu Tränen rührt. Alles richtig gemacht. Ansonsten die üblichen Songs. Das „Viva La Vida“-Coldplay-Cover funktioniert natürlich in so einer Location außerordentlich gut. Und als kleines vorgezogenes Nikolausgeschenk gibt’s als Zugabe die neue Weihnachtssingle „It Doesn’t Often Snow At Christmas“. Inklusive tanzender Weihnachtsbäume. Mehr Kitsch geht nicht, oder?
r: Wenn man die fulminante „Pandemonium“-Show des britischen Popduos bereits im Sommer gesehen hat, so wie wir zwei, dann ist die Wintertour natürlich erstaunlich überraschungsarm. Ich empfehle deshalb auch die Lektüre meiner Leipzig-Rezension im Juni. Die Show bleibt natürlich so toll, wie sie bereits beim ersten Mal war, mit dem schönen Unterschied, dass ich diesmal weiter vorn stand und das Ganze endlich auch mal wirklich sehen konnte. Ansonsten sind die Würfel immer noch das zentrale Element. Sie bauen sich auf, sie stürzen wieder ein, hängen an Schnüren oder werden von den Tänzern als Wurfgeschosse benutzt. Dazu gibt’s jede Menge Kostüme, Hintergrundvideos und Tanzeinlagen. Muss ja auch, da Tennant und Lowe das Gegenkonzept von Rampensäuen sind. Die geben sich weiterhin als gut gekleidete Gentleman des Elektropop und pfeffern fast die exakt gleiche Setlist aus dem Sommer um unsere Ohren, die sich aber nach wie vor sehr gut anhört. Natürlich sind da die Gassenhauer wie „Suburbia“, „It’s A Sin“ und „Always On My Mind“ dabei, die man schon nicht mehr hören kann, aber live durchaus Sinn machen. Auch „Go West“, welches glücklicherweise immer noch über die Beats von „Paninaro“ gelegt wird. Und dann sind da natürlich ein paar Mahsups, sowie das famose Oldschool-Special mit „Two Divided By Zero“ und „Why Don’t We Live Together?“ vom Debütalbum „Please“, welche beweisen, dass die Boys tatsächlich mal richtig cool klangen. Ansonsten gesellen sich das schnittige „New York City Boy“, sowie die Allzweckwaffe „What Have I Done To Deserve This?“ ins Programm. Nett, aber nicht weltbewegend. Glücklicherweise sorgen die Boys mit Musical Conductor Stuart Price immer wieder dafür, dass die Show nicht zu einer totalen Greatest-Hits-Revue verkommt. So gibt es die tolle 80er B-Seite „Do I Have To?“, welche nahtlos in das wunderbare „King’s Cross“ überläuft und zu Tränen rührt. Alles richtig gemacht. Ansonsten die üblichen Songs. Das „Viva La Vida“-Coldplay-Cover funktioniert natürlich in so einer Location außerordentlich gut. Und als kleines vorgezogenes Nikolausgeschenk gibt’s als Zugabe die neue Weihnachtssingle „It Doesn’t Often Snow At Christmas“. Inklusive tanzender Weihnachtsbäume. Mehr Kitsch geht nicht, oder?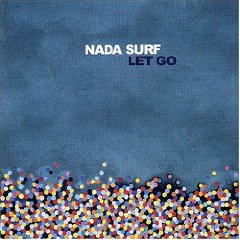 Nach vielen Wochen und unzähligen Alben sind wir nun in der Königskategorie angekommen und zwar bei meinen persönlichen Top 10 Alben aus dieser ausgehenden Dekade. Und um das ganze noch etwas dramaturgisch aufzuwerten, gibt’s das ganze jetzt häppchenweise… ich versuche sozusagen jeden Tag einen Platz zu posten und hoffe natürlich, dass ich dies zeitlich auch einigermaßen schaffe. Von vornherein sollte natürlich klar sein, dass jedes dieser zehn Alben ein absoluter Klassiker für mich ist und gerade hier die Anordnung sehr schwierig war. Den Einstieg macht das New Yorker Trio Nada Surf, bei denen sich Fans, Kritiker sowie vermutlich die Band selber, einig darüber sind, dass „Let Go“ aus dem Jahr 2002 das Meisterwerk dieser Band ist. Das Album, dass man nur einmal im Leben macht und bei dem alles stimmt. Und so ist es einfach aus. „Let Go“ ist auch nach über sieben Jahren immer noch eines der schönsten und qualitativ hochwertigsten Alben, welches ich kenne. Nada Surf perfektionieren ihren melodischen Indie-Rock auf wunderbare Art und Weise und vereinen zwölf hochwertige Songs auf einem Album. „Let Go“ ist wirklich ein Album, welches von den tollen Popsongs und Matthew Caws’ wundervoll ehrlichen und auch gefühlvollen Texten lebt und dabei eine ganz eigene Atmosphäre verbreitet, irgendwo zwischen Optimismus und bittersüßer Melancholie. Die rockigen Nummern „The Way You Wear Your Head“, “Hi-Speed Soul” oder das locker-leichte “No Quick Fix” laden zum Mitschunkeln und Tanzen ein. Die Balladen hingegen bewegen auf wunderbare Weise. Sei es die Verneigung vor Dylan’s „Blonde On Blonde“ oder das wunderbar ehrliche „Inside Of Love“, dass in all seinem traurigen Pragmatismus einfach so voller Wahrheit steckt. Und dann wär da noch das epische „Killian’s Red“, sowie der traumhafte Abschluss „Paper Boats“. „Sit on a train, reading a book. Same damn planet every time i look“ resümiert Caws darin. Dabei nimmt der Song einen mit auf die traurig melancholische Zugfahrt, durch eine Welt, der man sich irgendwie gern verweigern möchte. Egal, ob es um die große Liebe geht oder einfach nur die Fruchtfliegen in der Küche… „Let Go“ scheint ein Album mitten aus dem Leben zu sein, um am Ende doch irgendwie über ihm zu stehen. Ich finde keinen einzigen Schwachpunkt, na gut, vielleicht die französische Nummer… aber selbst das ist kein Beinbruch und mindert die Qualität von „Let Go“ in keinster Weise. Ein Album, welches mir über viele Jahre so viel gegeben hat und voller kleiner Wahrheiten ist. Seitdem bewegen sich Nada Surf immer auf angenehmen Niveau und lassen auch gern mal die Brillanz durchblicken, mit der sie Anno 2002 noch ein ganzes Album gefüllt haben. Ach, ist das traumhaft… ich hör’s mir gleich noch mal an.
Nach vielen Wochen und unzähligen Alben sind wir nun in der Königskategorie angekommen und zwar bei meinen persönlichen Top 10 Alben aus dieser ausgehenden Dekade. Und um das ganze noch etwas dramaturgisch aufzuwerten, gibt’s das ganze jetzt häppchenweise… ich versuche sozusagen jeden Tag einen Platz zu posten und hoffe natürlich, dass ich dies zeitlich auch einigermaßen schaffe. Von vornherein sollte natürlich klar sein, dass jedes dieser zehn Alben ein absoluter Klassiker für mich ist und gerade hier die Anordnung sehr schwierig war. Den Einstieg macht das New Yorker Trio Nada Surf, bei denen sich Fans, Kritiker sowie vermutlich die Band selber, einig darüber sind, dass „Let Go“ aus dem Jahr 2002 das Meisterwerk dieser Band ist. Das Album, dass man nur einmal im Leben macht und bei dem alles stimmt. Und so ist es einfach aus. „Let Go“ ist auch nach über sieben Jahren immer noch eines der schönsten und qualitativ hochwertigsten Alben, welches ich kenne. Nada Surf perfektionieren ihren melodischen Indie-Rock auf wunderbare Art und Weise und vereinen zwölf hochwertige Songs auf einem Album. „Let Go“ ist wirklich ein Album, welches von den tollen Popsongs und Matthew Caws’ wundervoll ehrlichen und auch gefühlvollen Texten lebt und dabei eine ganz eigene Atmosphäre verbreitet, irgendwo zwischen Optimismus und bittersüßer Melancholie. Die rockigen Nummern „The Way You Wear Your Head“, “Hi-Speed Soul” oder das locker-leichte “No Quick Fix” laden zum Mitschunkeln und Tanzen ein. Die Balladen hingegen bewegen auf wunderbare Weise. Sei es die Verneigung vor Dylan’s „Blonde On Blonde“ oder das wunderbar ehrliche „Inside Of Love“, dass in all seinem traurigen Pragmatismus einfach so voller Wahrheit steckt. Und dann wär da noch das epische „Killian’s Red“, sowie der traumhafte Abschluss „Paper Boats“. „Sit on a train, reading a book. Same damn planet every time i look“ resümiert Caws darin. Dabei nimmt der Song einen mit auf die traurig melancholische Zugfahrt, durch eine Welt, der man sich irgendwie gern verweigern möchte. Egal, ob es um die große Liebe geht oder einfach nur die Fruchtfliegen in der Küche… „Let Go“ scheint ein Album mitten aus dem Leben zu sein, um am Ende doch irgendwie über ihm zu stehen. Ich finde keinen einzigen Schwachpunkt, na gut, vielleicht die französische Nummer… aber selbst das ist kein Beinbruch und mindert die Qualität von „Let Go“ in keinster Weise. Ein Album, welches mir über viele Jahre so viel gegeben hat und voller kleiner Wahrheiten ist. Seitdem bewegen sich Nada Surf immer auf angenehmen Niveau und lassen auch gern mal die Brillanz durchblicken, mit der sie Anno 2002 noch ein ganzes Album gefüllt haben. Ach, ist das traumhaft… ich hör’s mir gleich noch mal an.
 Alles auf Anfang. Vor dem Stadionrock, vor “Clocks”, “Talk” und “Viva La Vida”, all den Grammys und Gwyneth Palthrow... da war “Parachutes”. Das Alpha in der Gleichung „Coldplay“. Das Album, welches alle Aufhören ließ, obwohl es eigentlich alles andere als laut war. Es war lediglich zur richtigen Zeit am richtigen Ort und besaß die richtigen Songs. Als die Welt zur Jahrtausendwende in Plastepop á la Britney und ’N Sync, sowie in Goldkettchen-Hip-Hop und Nu Metal, sowie diverser anderer 90er-Jahre-Leichen zu versinken drohte, läuteten Coldplay mit „Parachutes“ den Wechsel ein. Während Radiohead sich der Kunst und Oasis dem Kokain widmeten, schuf das Quartett Kunststudenten um den lockigen Chris Martin kleine, große Popsongs, die vor allem eines waren: Gefühlsecht, eingängig und emotional authentisch. Gut eben… durch und durch. Und so horchte die Welt auf, weil die Welt einen Hauch Ehrlichkeit nötig hatte. Und das mein ich nicht nur auf globaler Ebene, denn selbst mich haben Coldplay damit gerettet. Als ich das erste Mal „Trouble“ hörte, öffnete sich vor meinem musikalischen Auge bzw. Ohr eine komplett neue Welt, welche ich in der Form nicht kannte. So sorgten Coldplay dafür, dass ich ganz persönlich eine neue Stufe in meinem Musikkonsum erklomm und mich von da an wirklich abseits von dem bewegte, was die Mitschüler damals so toll fanden. „Parachutes“ war der Startschuss für mich und sicher auch für viele andere. Die Brillanz der Songs bleibt unbestritten, da könnnen sich damals weder Bono noch P. Diddy irren. Der wunderbar leichte Schmerz, der das Album durchweht, seien es die düsteren Momente wie „Spies“ oder die romantischen wie „Sparks“ oder „We Never Change“. Und mit „Shiver“ oder „Everything’s Not Lost“ empfiehlt man sich bereits auf diesem Album für die großen Hymnen der Zukunft. Doch noch hält sich das alles in Grenzen. „Parachutes“ ist ein wunderbar ehrliches und smiples Album voller kleiner Songperlen, deren Emotionen man in jeder Minute abkauft. Eine ganze eigene, heimische Atmosphäre, die so gar nichts mit all dem zu tun hat, was Coldplay in den nächsten Jahren machen sollten. Vielleicht sind deshalb auch viele alte Fans bereits nach dem Debüt angesprungen. Ein leises, fast schon schüchternes Ausrufezeichen einer Band, von der man damals nur erahnen konnte, zu was sie noch alles fähig ist, wenn man sie lässt. Ein ganz persönlicher lebensrettender Fallschirm, der in den vergangenen fast zehn Jahren nichts von seiner Einzigartigkeit verloren hat.
Alles auf Anfang. Vor dem Stadionrock, vor “Clocks”, “Talk” und “Viva La Vida”, all den Grammys und Gwyneth Palthrow... da war “Parachutes”. Das Alpha in der Gleichung „Coldplay“. Das Album, welches alle Aufhören ließ, obwohl es eigentlich alles andere als laut war. Es war lediglich zur richtigen Zeit am richtigen Ort und besaß die richtigen Songs. Als die Welt zur Jahrtausendwende in Plastepop á la Britney und ’N Sync, sowie in Goldkettchen-Hip-Hop und Nu Metal, sowie diverser anderer 90er-Jahre-Leichen zu versinken drohte, läuteten Coldplay mit „Parachutes“ den Wechsel ein. Während Radiohead sich der Kunst und Oasis dem Kokain widmeten, schuf das Quartett Kunststudenten um den lockigen Chris Martin kleine, große Popsongs, die vor allem eines waren: Gefühlsecht, eingängig und emotional authentisch. Gut eben… durch und durch. Und so horchte die Welt auf, weil die Welt einen Hauch Ehrlichkeit nötig hatte. Und das mein ich nicht nur auf globaler Ebene, denn selbst mich haben Coldplay damit gerettet. Als ich das erste Mal „Trouble“ hörte, öffnete sich vor meinem musikalischen Auge bzw. Ohr eine komplett neue Welt, welche ich in der Form nicht kannte. So sorgten Coldplay dafür, dass ich ganz persönlich eine neue Stufe in meinem Musikkonsum erklomm und mich von da an wirklich abseits von dem bewegte, was die Mitschüler damals so toll fanden. „Parachutes“ war der Startschuss für mich und sicher auch für viele andere. Die Brillanz der Songs bleibt unbestritten, da könnnen sich damals weder Bono noch P. Diddy irren. Der wunderbar leichte Schmerz, der das Album durchweht, seien es die düsteren Momente wie „Spies“ oder die romantischen wie „Sparks“ oder „We Never Change“. Und mit „Shiver“ oder „Everything’s Not Lost“ empfiehlt man sich bereits auf diesem Album für die großen Hymnen der Zukunft. Doch noch hält sich das alles in Grenzen. „Parachutes“ ist ein wunderbar ehrliches und smiples Album voller kleiner Songperlen, deren Emotionen man in jeder Minute abkauft. Eine ganze eigene, heimische Atmosphäre, die so gar nichts mit all dem zu tun hat, was Coldplay in den nächsten Jahren machen sollten. Vielleicht sind deshalb auch viele alte Fans bereits nach dem Debüt angesprungen. Ein leises, fast schon schüchternes Ausrufezeichen einer Band, von der man damals nur erahnen konnte, zu was sie noch alles fähig ist, wenn man sie lässt. Ein ganz persönlicher lebensrettender Fallschirm, der in den vergangenen fast zehn Jahren nichts von seiner Einzigartigkeit verloren hat.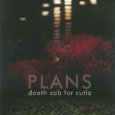 Es gab die Death Cab vor “Plans”, die Erwartungen schürten und dann die Death Cab nach „Plans“, die seit dem irgendwie nicht wissen wohin sie wollen. Und dazwischen gibt es halt „Plans“, das Album von dem ich mir noch nicht ganz getraue zu sagen, es zeige die Band auf ihrem Zenit, wenngleich es allerdings immer stärker danach aussieht. Bleiben wir beim bisher stärksten Album des Quartetts aus Seattle. Nachdem man sich vorher von album zu Album gesteigert hatte, erreicht die Band um Ben Gibbard auf „Plans“ einen qualitativen Level auf dem ihrem melancholischen Indie Pop scheinbar alles gelingen kann. Keine Schwachstellen. All Killer, No Filler. Vom ersten Moment an, als die Keyboardflächen von “Marching Bands Of Manhatten“ einen willkommen heißen, nimmt einen dieses Album mit auf eine spannende Reise voller kleiner, großer Gitarrenkunstwerke. Dabei lässt man das Stürmische und Rauhe vergangener Death-Cab-Tage ein wenig hinter sich und zeigt sich auf „Plans“ von der ganz gefühlvollen und weichen Seite, was an sich ja nicht vekehrt ist. So gibt es hier wunderbare Liebeslieder, wie das fröhlich-beschwingte „Soul Meets Body“ oder die Understatement-Hymne „Your Heart Is An Empty Room“. Und es wird auch traurig, wie „Summer Skin“, auf dem Gibbard das Ende einer Liebe besingt oder in „Someday You Will Be Loved“, in welchem er der Verflossenen alles Gute wünscht. Egal, ob die melancholische Schwere der „Brothers On A Hotel Bed“ oder das rein akustische Liebesbekenntnis „I Will Follow You Into The Dark“… die Band gibt sich vielfältig und dabei immer sehr bewegend. Dazu besitzt „Plans“ auch einen ganz eigenen Klang mit seinen warmen Keyboardflächen, den weichen Gitarren, sowie dem prägnanten Piano. Ein Klang, den man zwar in Ansätzen auch auf allen anderen Death Cab For Cutie Platten findet, jedoch niemals so perfektioniert und gut produziert, wie an dieser Stelle. So versprüht „Plans“ unglaublich viel Herzlichkeit und Geborgenheit von der ersten bis zur letzten Note. Das hat sie jedenfalls stets wann immer ich sie gehört habe. Wunderbar intelligente Gitarrenpopsongs, welche die Band musikalisch noch einmal ordentlich nach vorn bringen und ganz neue Seiten zeigt. Dass man im Zuge dieses Albums auch noch mal einen ordentlichen Popularitätsschub genossen hat, erstaunt eigentlich auch nicht wirklich. O.C. California hin oder her. „Plans“ bleibt das stille Meisterwerk dieser Band, an dem sich nun halt leider mal alle zukünftigen Alben messen lassen müssen. Aber da ist der offen noch lang nicht aus. Da bleibe ich, ganz im Sinne des Albums und trotz Twilight-Soundtrack, ein grenzenloser Optimist.
Es gab die Death Cab vor “Plans”, die Erwartungen schürten und dann die Death Cab nach „Plans“, die seit dem irgendwie nicht wissen wohin sie wollen. Und dazwischen gibt es halt „Plans“, das Album von dem ich mir noch nicht ganz getraue zu sagen, es zeige die Band auf ihrem Zenit, wenngleich es allerdings immer stärker danach aussieht. Bleiben wir beim bisher stärksten Album des Quartetts aus Seattle. Nachdem man sich vorher von album zu Album gesteigert hatte, erreicht die Band um Ben Gibbard auf „Plans“ einen qualitativen Level auf dem ihrem melancholischen Indie Pop scheinbar alles gelingen kann. Keine Schwachstellen. All Killer, No Filler. Vom ersten Moment an, als die Keyboardflächen von “Marching Bands Of Manhatten“ einen willkommen heißen, nimmt einen dieses Album mit auf eine spannende Reise voller kleiner, großer Gitarrenkunstwerke. Dabei lässt man das Stürmische und Rauhe vergangener Death-Cab-Tage ein wenig hinter sich und zeigt sich auf „Plans“ von der ganz gefühlvollen und weichen Seite, was an sich ja nicht vekehrt ist. So gibt es hier wunderbare Liebeslieder, wie das fröhlich-beschwingte „Soul Meets Body“ oder die Understatement-Hymne „Your Heart Is An Empty Room“. Und es wird auch traurig, wie „Summer Skin“, auf dem Gibbard das Ende einer Liebe besingt oder in „Someday You Will Be Loved“, in welchem er der Verflossenen alles Gute wünscht. Egal, ob die melancholische Schwere der „Brothers On A Hotel Bed“ oder das rein akustische Liebesbekenntnis „I Will Follow You Into The Dark“… die Band gibt sich vielfältig und dabei immer sehr bewegend. Dazu besitzt „Plans“ auch einen ganz eigenen Klang mit seinen warmen Keyboardflächen, den weichen Gitarren, sowie dem prägnanten Piano. Ein Klang, den man zwar in Ansätzen auch auf allen anderen Death Cab For Cutie Platten findet, jedoch niemals so perfektioniert und gut produziert, wie an dieser Stelle. So versprüht „Plans“ unglaublich viel Herzlichkeit und Geborgenheit von der ersten bis zur letzten Note. Das hat sie jedenfalls stets wann immer ich sie gehört habe. Wunderbar intelligente Gitarrenpopsongs, welche die Band musikalisch noch einmal ordentlich nach vorn bringen und ganz neue Seiten zeigt. Dass man im Zuge dieses Albums auch noch mal einen ordentlichen Popularitätsschub genossen hat, erstaunt eigentlich auch nicht wirklich. O.C. California hin oder her. „Plans“ bleibt das stille Meisterwerk dieser Band, an dem sich nun halt leider mal alle zukünftigen Alben messen lassen müssen. Aber da ist der offen noch lang nicht aus. Da bleibe ich, ganz im Sinne des Albums und trotz Twilight-Soundtrack, ein grenzenloser Optimist. So, nach all der Melancholie hier muss auch mal wieder Platz für zünftige Gitarren, flotte Bassläufe und etwas Rock’n Roll in der Disko sein. Natürlich hat die Indie-Welle zu Mitte des Jahrzehnts in England einige feiste Bands ans Tageslicht gespühlt, die alle auf ihre Weise begeistern konnten. Und darunter befinden sich definitiv die besten Debüts dieses Jahrzehnts. Doch eine Band sticht mit einem Album deutlich heraus und kann, wenn es nach mir geht, sogar die Konkurrenz von Maximo Park, Franz Ferdinand und Arctic Monkeys spielend hinter sich lassen. Das Debütalbum „No Love Lost“, der Rifles aus London ist eines der besten Debüts der vergangenen zehn Jahre, welches vor allem deshalb beeindruckend ist, weil es ausnahmslos zwölf Songs serviert, die alle für sich astreine Hits sind. Ich weiß, den Satz sagt man öfters, aber hier stimmt das… wirklich! Du kannst jeden Song nehmen, vom Opener „She’s Got Standards“ über den „Hometown Blues“, bis hin zu den eigentlichen Singles „Peace & Quiet“ oder „Repeated Offender“… jeder Song ist ein lupenreines Lehrstück dafür, wie ein Gitarrenpopsong in dreieinhalb Minuten zu funktionieren hat. Strophe, Chorus, Strophe, Chorus, Bridge, Chorus… und das klappt auch, weil es astrein produziert und auf den Punkt gebracht ist und das Quartett aus London akribisch genau darauf achtet, dass man auch schön jeden Refrain mitsingen kann. Am besten gleich mehrstimmig aufnehmen, damit gleich jeder den Mitgröhlrefrain checkt. Und dazu noch ein paar lebensnahe, etwas bissige Texte genommen über Themen, die einen als junge Gitarrenband halt so interessieren. Sei es der eigene Hype, das Pro und Contra von One Night Stands, der Wunsch nach Ruhe, der lokale Looser im Pub oder das mulmige Gefühl, welches einen beschleicht, wenn man nach langer Zeit mal wieder in seiner Heimat aufschlägt… kennt man, liebt man, singt man bedingungslos auch nach ein paar Bier noch mit. The Rifles sind die stereotypischen britischen Working Class Heroes, die auf ihrem Debüt all das verkörpern, was man an der Gitarrenpopmusik dieses Landes so gut findet oder eben nicht. Sogar die Balladen bekommt man hin. Selten klang eine Liebeserklärung so aufrichtig, wie in „Spend A Lifetime“. Und die Gesellschaftskritik in „Narrow Minded Social Club“ ist auch wundervoll. Und lässt sich trotzdem mitgröhlen. Ja, selbst der Hidden Track „Fat Cat“ hat’s faustdick hinter den Ohren. Auf „No Love Lost“ stimmt alles. Form, Inhalt und Attitüde verschmelzen zu einem kurzweiligen und unwiderstehlichen Gitarrenpopmix, der es geschafft hat, mir mehrere Sommer zu versüßen. Und fragen sie bitte auch den doughnut, der hier im Blog rumgeistert. Der vermutlich größte Rifles-Fan dieses Landes. Auch nach über drei Jahren hat „No Love Lost“ nichts von dieser Energie, diesem Lebensgefühl verloren, welches damals, 2006, so faszinierte. Die Band wird von nun an gegen ihre eigene Messlatte ankämpfen müssen. Das tut sie bisher aber mit Bravur. Good lads!
So, nach all der Melancholie hier muss auch mal wieder Platz für zünftige Gitarren, flotte Bassläufe und etwas Rock’n Roll in der Disko sein. Natürlich hat die Indie-Welle zu Mitte des Jahrzehnts in England einige feiste Bands ans Tageslicht gespühlt, die alle auf ihre Weise begeistern konnten. Und darunter befinden sich definitiv die besten Debüts dieses Jahrzehnts. Doch eine Band sticht mit einem Album deutlich heraus und kann, wenn es nach mir geht, sogar die Konkurrenz von Maximo Park, Franz Ferdinand und Arctic Monkeys spielend hinter sich lassen. Das Debütalbum „No Love Lost“, der Rifles aus London ist eines der besten Debüts der vergangenen zehn Jahre, welches vor allem deshalb beeindruckend ist, weil es ausnahmslos zwölf Songs serviert, die alle für sich astreine Hits sind. Ich weiß, den Satz sagt man öfters, aber hier stimmt das… wirklich! Du kannst jeden Song nehmen, vom Opener „She’s Got Standards“ über den „Hometown Blues“, bis hin zu den eigentlichen Singles „Peace & Quiet“ oder „Repeated Offender“… jeder Song ist ein lupenreines Lehrstück dafür, wie ein Gitarrenpopsong in dreieinhalb Minuten zu funktionieren hat. Strophe, Chorus, Strophe, Chorus, Bridge, Chorus… und das klappt auch, weil es astrein produziert und auf den Punkt gebracht ist und das Quartett aus London akribisch genau darauf achtet, dass man auch schön jeden Refrain mitsingen kann. Am besten gleich mehrstimmig aufnehmen, damit gleich jeder den Mitgröhlrefrain checkt. Und dazu noch ein paar lebensnahe, etwas bissige Texte genommen über Themen, die einen als junge Gitarrenband halt so interessieren. Sei es der eigene Hype, das Pro und Contra von One Night Stands, der Wunsch nach Ruhe, der lokale Looser im Pub oder das mulmige Gefühl, welches einen beschleicht, wenn man nach langer Zeit mal wieder in seiner Heimat aufschlägt… kennt man, liebt man, singt man bedingungslos auch nach ein paar Bier noch mit. The Rifles sind die stereotypischen britischen Working Class Heroes, die auf ihrem Debüt all das verkörpern, was man an der Gitarrenpopmusik dieses Landes so gut findet oder eben nicht. Sogar die Balladen bekommt man hin. Selten klang eine Liebeserklärung so aufrichtig, wie in „Spend A Lifetime“. Und die Gesellschaftskritik in „Narrow Minded Social Club“ ist auch wundervoll. Und lässt sich trotzdem mitgröhlen. Ja, selbst der Hidden Track „Fat Cat“ hat’s faustdick hinter den Ohren. Auf „No Love Lost“ stimmt alles. Form, Inhalt und Attitüde verschmelzen zu einem kurzweiligen und unwiderstehlichen Gitarrenpopmix, der es geschafft hat, mir mehrere Sommer zu versüßen. Und fragen sie bitte auch den doughnut, der hier im Blog rumgeistert. Der vermutlich größte Rifles-Fan dieses Landes. Auch nach über drei Jahren hat „No Love Lost“ nichts von dieser Energie, diesem Lebensgefühl verloren, welches damals, 2006, so faszinierte. Die Band wird von nun an gegen ihre eigene Messlatte ankämpfen müssen. Das tut sie bisher aber mit Bravur. Good lads! Halleluhja! Im Gegensatz zur Konkurrenz benötigte das Künstlerkollektiv Arcade Fire aus Kanada gerade mal zwei Alben, um die Musikwelt in Ehrfurcht zu erschüttern und alle für sich zu begeistern. Von der Spex bis zur Süddeutschen, von Bono bis Bowie. Alle sind sich einig! Kaum eine Band wird von Kollegen, wie Fans gleichermaßen hoch gelobt wie die Band um Win Buttler und Régine Chassagne. Man ist fast schon gewillt bewusst, nach Fehlern zu suchen. Nach dem Haar in der Suppe. Doch einmal „Neon Bible“ gehört, bleibt mir am Ende nichts anderes als im Staub zu knien und Buße zu tun. Die Band schafft das fast Unmögliche. Das ohnehin schon geniale Debüt „Funeral“ wird mit „Neon Bible“ fast noch übertrumpft. Ein Triumphzug sondergleichen. Und sobald das nervöse Brodeln des Openers „Black Mirror“ beginnt, ist man gefangen in dieser fantastischen, hymnischen Welt. Wobei es dabei nicht mal eine Fantasiewelt ist, sondern unsere Welt. Jeder Song, um in der Bibelsprache zu bleiben, eine Offenbarung für sich. Von den todtraurigen Balladen „Ocean of Noise“ oder „Windowsill“, bis hin zu diesen unglaublichen Hymnen wie „No Cars Go“ oder „Intervention“, die alles auffahren, was man auffahren kann. Orchester, Chöre und eine hauseigene Kirchenorgel. Alles andere wäre zu mickrig. Es ist der größte Verdienst von Arcade Fire, dass sie neben den Standard-Instrumentenrepertoire einer Indieband auch spielend leicht alles Andere, von der Flöte, über Harfen, bis hin zu Cello und Drehorgel in ihrer Musik benutzen und damit ihren Songs die Größe verleihen, die ihnen auch zusteht. Überhaupt halten Arcade Fire nix von der Einfachheit anderer Künstler. Der beste Beweis dafür, dass Popmusik und große Produktion auch abseits von Klischees und Schwulst funktionieren kann. Diese Musik will groß sein, sie will episch und hymnenhaft sein, verliert dabei aber nie ihre Intensität und ihr Gefühl. Und weil all diese Elemente so gut passen, kann ich als Freund guter Musik auch nicht anders, als diese Band zu lieben. Arcade Fire verpacken ihre Songs über die Probleme dieser Welt und die Probleme eines jeden einzelnen in große, verzweifelte, aber doch auch irgendwie trostspendende Popmomente. „Windowsill“ wünscht sich all den Mist, den man täglich vom Fenstersims aus sieht weg und „No Cars Go“ wünscht sich in eine mit Pauken und Chören durchsetzte Traumwelt. Oder vielleicht sogar in den Tod als Erslösung selber? Selten war Suizid so schön verpackt. „Set My Spirit Free“ fleht Buttler im famosen Abschlusssong „My Body Is A Cage“, begleitet von der ganzen Band und ihrer Orgel. Ein Flehen nach einer besseren Welt. Eine Band, die politischer ist, als man ihr immer zutraut. Am Ende bleibt einfach dieses Gefühl der Überwältigung. Man ist Zeuge wunderbarer Musik geworden, die im Idealfall natürlich lebensrettend ist. „Neon Bible“ ist bereits jetzt ein moderner Klassiker, der Lust auf mehr macht. Und eigentlich wär ein neues Album 2010 ja fällig, liebes Spielhallenfeuer. Auf das du noch eine Weile weiter lodern wirst!
Halleluhja! Im Gegensatz zur Konkurrenz benötigte das Künstlerkollektiv Arcade Fire aus Kanada gerade mal zwei Alben, um die Musikwelt in Ehrfurcht zu erschüttern und alle für sich zu begeistern. Von der Spex bis zur Süddeutschen, von Bono bis Bowie. Alle sind sich einig! Kaum eine Band wird von Kollegen, wie Fans gleichermaßen hoch gelobt wie die Band um Win Buttler und Régine Chassagne. Man ist fast schon gewillt bewusst, nach Fehlern zu suchen. Nach dem Haar in der Suppe. Doch einmal „Neon Bible“ gehört, bleibt mir am Ende nichts anderes als im Staub zu knien und Buße zu tun. Die Band schafft das fast Unmögliche. Das ohnehin schon geniale Debüt „Funeral“ wird mit „Neon Bible“ fast noch übertrumpft. Ein Triumphzug sondergleichen. Und sobald das nervöse Brodeln des Openers „Black Mirror“ beginnt, ist man gefangen in dieser fantastischen, hymnischen Welt. Wobei es dabei nicht mal eine Fantasiewelt ist, sondern unsere Welt. Jeder Song, um in der Bibelsprache zu bleiben, eine Offenbarung für sich. Von den todtraurigen Balladen „Ocean of Noise“ oder „Windowsill“, bis hin zu diesen unglaublichen Hymnen wie „No Cars Go“ oder „Intervention“, die alles auffahren, was man auffahren kann. Orchester, Chöre und eine hauseigene Kirchenorgel. Alles andere wäre zu mickrig. Es ist der größte Verdienst von Arcade Fire, dass sie neben den Standard-Instrumentenrepertoire einer Indieband auch spielend leicht alles Andere, von der Flöte, über Harfen, bis hin zu Cello und Drehorgel in ihrer Musik benutzen und damit ihren Songs die Größe verleihen, die ihnen auch zusteht. Überhaupt halten Arcade Fire nix von der Einfachheit anderer Künstler. Der beste Beweis dafür, dass Popmusik und große Produktion auch abseits von Klischees und Schwulst funktionieren kann. Diese Musik will groß sein, sie will episch und hymnenhaft sein, verliert dabei aber nie ihre Intensität und ihr Gefühl. Und weil all diese Elemente so gut passen, kann ich als Freund guter Musik auch nicht anders, als diese Band zu lieben. Arcade Fire verpacken ihre Songs über die Probleme dieser Welt und die Probleme eines jeden einzelnen in große, verzweifelte, aber doch auch irgendwie trostspendende Popmomente. „Windowsill“ wünscht sich all den Mist, den man täglich vom Fenstersims aus sieht weg und „No Cars Go“ wünscht sich in eine mit Pauken und Chören durchsetzte Traumwelt. Oder vielleicht sogar in den Tod als Erslösung selber? Selten war Suizid so schön verpackt. „Set My Spirit Free“ fleht Buttler im famosen Abschlusssong „My Body Is A Cage“, begleitet von der ganzen Band und ihrer Orgel. Ein Flehen nach einer besseren Welt. Eine Band, die politischer ist, als man ihr immer zutraut. Am Ende bleibt einfach dieses Gefühl der Überwältigung. Man ist Zeuge wunderbarer Musik geworden, die im Idealfall natürlich lebensrettend ist. „Neon Bible“ ist bereits jetzt ein moderner Klassiker, der Lust auf mehr macht. Und eigentlich wär ein neues Album 2010 ja fällig, liebes Spielhallenfeuer. Auf das du noch eine Weile weiter lodern wirst!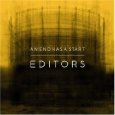 Darf’s etwas mehr sein? Wenn eine Band ihren Sound gern etwas größer gestalten will, ist der schottische Produzent Jacknife Lee meist eine gute Adresse. Immerhin ging der bei U2 in die Schule. Und nachdem das Debüt „The Back Room“ von den Editors bereits 2005 immer wieder nach der großen Bühne schrie, bekam der Nachfolge gleich die volle Dröhnung. Mehr Gitarren, mehr Pomp, mehr Soundwände… Mehr! Mehr!! Mehr!!! Es scheint so, als bekommt die Band auf “An End Has A Start” endlich den Sound, der ihnen gebührt. Ein Sound der nach der großen Bühne schreit. Die ganz großen Gesten, die der schlacksige Frontmann Tom Smith ja auch gern auf der Bühne bis zum Exzess lebt, in XXL. Und natürlich die wunderbaren Texte über Tod, Vergänglichkeit und all die düsteren Themen unserer Existenz. Das spricht mich und meine immer gern wiederkehrende Teenage Angst an. Also ist das Zweitwerk der Editors das ganz große Leiden mit zirpenden Gitarren und wuchtigem Schlagzeug. Der Opener „Smokers Outside The Hospital Doors“ breitet bereits seine Arme gaaaanz weit aus um wirklich alle in der Stadt willkommen zu heißen. Und mit „An End Has A Start“, „Bones“ oder „The Racing Rats“ hat man auch wieder die unwiderstehlichen Indie-Disco-Hits dabei, welche Jacknife Lee diesmal noch stärker auf Tanzen getrimmt hat. Doch dann ist da noch der Rest. Die unglaubliche Dringlichkeit dieses Hammerriffs von „Escape The Nest“, das Flehen nach Flucht in seinem Aufbau und in der Stimme von Tom Smith. Ja, ich fliehe mit, Tom! Lenk den Fluchtwagen! Und dazu so düstere Liebeslieder wie das epische „The Weight Of The World“. „Love replaces fear“ singt Smith da. Und in dem Moment als er dies in dem Song tut, flutet ein warmes Licht den Raum und erfüllt alles und jeden. Schlagzeug, Gitarre, Bass und Klavier drücken jeden Song in seinem Ausdruck nach vorn. Diese Musik will sich nicht verstecken, sie will raus und gehört werden. Vermutlich rastet Smith deshalb gern mal so auf der Bühne aus. Dieser dürre Mann mit dem Lockenkopf und der markanten Stimme. Hier schreit er alles heraus. Seine Angst, seinen Frust, seine Zweifel! Unüberhörbar! Vielleicht übertreiben es Band und Produzent an manchen Stellen auch ein wenig, denn teilweise wirkt „An End Has A Start“ richtig dick aufgetragen. Doch das verzeih ich ihnen gern. Selbst wenn das neue Album dieses noch mal durch eindrucksvolle musikalische Neuausrichtung in den Schatten stellt… das zweite Album der Editors bleibt ein persönlicher Meilenstein in meiner musikalischen Hörentwicklung. Ein Album, das damals, wie heute unglaublich wichtig war und geholfen hat, diese Band als eine meiner Top-Bands für alle Zeit zu etablieren, obwohl es sie noch gar nicht so lang gibt. Toppen kann dies nur das Debüt und das findet sich, welch Überraschungen, in der Top 10, welcher uns wir nun in nächster Zeit feierlich zuwenden werden.
Darf’s etwas mehr sein? Wenn eine Band ihren Sound gern etwas größer gestalten will, ist der schottische Produzent Jacknife Lee meist eine gute Adresse. Immerhin ging der bei U2 in die Schule. Und nachdem das Debüt „The Back Room“ von den Editors bereits 2005 immer wieder nach der großen Bühne schrie, bekam der Nachfolge gleich die volle Dröhnung. Mehr Gitarren, mehr Pomp, mehr Soundwände… Mehr! Mehr!! Mehr!!! Es scheint so, als bekommt die Band auf “An End Has A Start” endlich den Sound, der ihnen gebührt. Ein Sound der nach der großen Bühne schreit. Die ganz großen Gesten, die der schlacksige Frontmann Tom Smith ja auch gern auf der Bühne bis zum Exzess lebt, in XXL. Und natürlich die wunderbaren Texte über Tod, Vergänglichkeit und all die düsteren Themen unserer Existenz. Das spricht mich und meine immer gern wiederkehrende Teenage Angst an. Also ist das Zweitwerk der Editors das ganz große Leiden mit zirpenden Gitarren und wuchtigem Schlagzeug. Der Opener „Smokers Outside The Hospital Doors“ breitet bereits seine Arme gaaaanz weit aus um wirklich alle in der Stadt willkommen zu heißen. Und mit „An End Has A Start“, „Bones“ oder „The Racing Rats“ hat man auch wieder die unwiderstehlichen Indie-Disco-Hits dabei, welche Jacknife Lee diesmal noch stärker auf Tanzen getrimmt hat. Doch dann ist da noch der Rest. Die unglaubliche Dringlichkeit dieses Hammerriffs von „Escape The Nest“, das Flehen nach Flucht in seinem Aufbau und in der Stimme von Tom Smith. Ja, ich fliehe mit, Tom! Lenk den Fluchtwagen! Und dazu so düstere Liebeslieder wie das epische „The Weight Of The World“. „Love replaces fear“ singt Smith da. Und in dem Moment als er dies in dem Song tut, flutet ein warmes Licht den Raum und erfüllt alles und jeden. Schlagzeug, Gitarre, Bass und Klavier drücken jeden Song in seinem Ausdruck nach vorn. Diese Musik will sich nicht verstecken, sie will raus und gehört werden. Vermutlich rastet Smith deshalb gern mal so auf der Bühne aus. Dieser dürre Mann mit dem Lockenkopf und der markanten Stimme. Hier schreit er alles heraus. Seine Angst, seinen Frust, seine Zweifel! Unüberhörbar! Vielleicht übertreiben es Band und Produzent an manchen Stellen auch ein wenig, denn teilweise wirkt „An End Has A Start“ richtig dick aufgetragen. Doch das verzeih ich ihnen gern. Selbst wenn das neue Album dieses noch mal durch eindrucksvolle musikalische Neuausrichtung in den Schatten stellt… das zweite Album der Editors bleibt ein persönlicher Meilenstein in meiner musikalischen Hörentwicklung. Ein Album, das damals, wie heute unglaublich wichtig war und geholfen hat, diese Band als eine meiner Top-Bands für alle Zeit zu etablieren, obwohl es sie noch gar nicht so lang gibt. Toppen kann dies nur das Debüt und das findet sich, welch Überraschungen, in der Top 10, welcher uns wir nun in nächster Zeit feierlich zuwenden werden.