Lieblingsalben 2009 / Platz 15 - 11
15. Arctic Monkeys “Humbug”
Wenn gar nix mehr geht, geht immerhin noch die Wüste. Zumindest für manche Bands. Schon U2 haben sich damals da bei „Joshua Tree“ ein paar neue Ideen holen können. Nun also auch die Arctic Monkeys, die größte britische Musikentdeckung des Jahrzehnts. Na ja, wenn man der Presse halt glauben schenken darf. Auf dem sehnsüchtig erwarteten Drittwerk der britischen Senkrechtstarter wird die konsequente Entwicklung der vergangenen Jahre fortgesetzt. Leichte Mitsing-Songs, wie auf dem Debüt sucht man auf „Humbug“ vergebens. Die Dunkelheit und das geheimnisvolle, welche die Band bisher textlich öfters herüberbringen konnte, bekommt nun endlich das musikalische Gewand. So bietet „Humbug“ zehn schrullige Anti-Hits, sich mit allerhand Psychodelic-Anleihen tief in die 60er wagen und dennoch hochmodern klingen. Zwischendurch schaltet man gern auch mal einen Gang herunter, wie beim traurigen „Cornerstone“ oder dem düsteren „Dance Little Liar“, dem versteckten Highlight der Platte. Dann wird’s aber auch mal richtig laut, es gibt Gitarrensoli und Metal-Momente. Es wirkt so, als ob Produzent Josh Homme es endlich geschafft hat, den Sound der Monkeys nach außen zu kehren. Jener Sound, der schon immer irgendwie an bestimmten Stellen durchblitzte und nun endgültig nach vorn rückt. Ach, sie sind so schnell erwachsen geworden, unsere vier Monkeys. Mit dem locker-leichten Teenager-Debüt „Whatever People Say...“ hat das alles nichts mehr zu tun. Das wirkt mittlerweile eher wie der eigentlich Fremdkörper in der Discography. „Humbug“ ist nicht das Werk von vier jungen Lads, sondern von hochmusikalischen jungen Männern. Es klingt nach dem Sand der Wüste, dunklen Nächten und vernebelten Bars. Westernromantik, wo es eigentlich gar keine gibt. Melodien, die eigentlich gar keine sind und Refrains, die man halt immer erst suchen muss. Dafür spielt die Band hervorragend, stellenweise geradezu virtuos auf. Die haben was drauf und „Humbug“ ist der endgültige Beweis dafür. Vermutlich springen nun all die Fast-Food-Indie-Kids teilweise ab, aber das muss man in Kauf nehmen um nicht als Eintagsfliege zu gelten. Die Arctic Monkeys spielen schroff und kantig gegen ihre eigene Legendenbildung ab. Und während die oft zum Vergleich gezogenen Oasis damals bei Album Nr. 3 im Größenwahn und Drogenkonsum versanken, punkten die Herren um Alex Turner lieber musikalisch. Das schöne an „Humbug“ ist wirklich, dass man es sich immer wieder anhören kann, ohne dass es schnell nervt. Gelegentlich entdeckt man auch neue Facetten und Ideen, welche man in dieser Form noch nicht gehört hatte. Eine rundum gelungene Neudefinition. Mal schauen, was da die nächsten Jahre noch so um die Ecke kommt.
Anhören: “My Propeller”, “Crying Lightning”, “Cornerstone”, “Dance Little Liar”
14. White Lies „To Lose My Life“
Also um das gleich mal von Beginn an festzuhalten: das Debütalbum der White Lies ist weder eine Offenbarung noch eine musikalische Revolution. Im Gegenteil: hier werden uns diverse Versatzstücke aus bekannten musikalischen Anleihen der letzten Jahre präsentiert. Ein bisschen Editors hier, etwas Killers dort. Na ja, und da muss man natürlich Zwangsläufig die 80er mit dazunehmen. Klingt auch teilweise gern mal nach den Tears For Fears. Letztendlich sind die White Lies eine Art glattgebügelte Ausgabe des Post-Punkt-Wave-Revivals. Das ganze funktioniert aber dennoch sehr gut, weil es die zehn Songs auf „To Lose My Life“ halt faustdick hinter den Ohren haben. Tolle Songs, kaum Ausfälle. Die Band spielt mit dem düsteren Charme vom 80er-New-Wave und erzeugt so allerhand Popsongs zum Thema Tod, Verzweiflung, Abschied und so weiter. Immerhin heißt der Eröffnungstrack ja auch „Death“. Der Titeltrack, sowie „Farewell To The Fairground“ gehen ordentlich nach vorn, während sich andere Nummern wie „For The Stars“ oder „Nothing To Give“ eher einer ruhigen Atmosphäre bedienen. Aber ich mag ja so darken 80er-Kram. Die treibenden Drums, der vibrierende Bass und die zackigen Delay-Gitarren halt. Und dazu besitzt Sänger Harry McVeigh auch noch eine dieser flehenden Stimmen, die von „ganz tief düster“ bis „hoch flehend“ jede Menge Spektren abdecken können. Fans der oben genannten Bands können also Spaß an dem Trio aus London haben. Was letztendlich eine höhere Platzierung und einen Stellenwert wie bspw. den der Editors bei mir verhindert hat, ist die Tatsache, dass „To Lose My Life“ wirklich sehr stark auf Hochglanz poliert ist. Die fehlenden Ecken und Kanten nehmen natürlich etwas von der Atmosphäre weg, zumal McVeighs Texte teilweise wirklich etwas reißbrettartig daher kommen. Im Prinzip hätte etwas weniger von allem dem Album durchaus gut getan. Aber so ist es halt, was es ist und mir soll’s recht sein. Ein kurzweiliges, sehr eingängiges Poprock-Album mit einem schön düsteren 80er-Einschlag und einigen recht großen Hits. Wer also, wie ich ein Fabel für Musik in diese Richtung hat, dem sollte das Werk nicht entgangen sein. Ansonsten bitte mal nachholen.
Anhören: “To Lose My Life”, “E.S.T.”, “From The Stars”, “Farewell To The Fairground
13. Depeche Mode “Sounds Of The Universe”
Kultbandalarm! Mit regelmäßigen Abstand melden sich die alten 80er Hautdegen und persönlichen Favoriten von mir, Depeche Mode mit einem neuen Album zurück. Diesmal waren es „nur“ 3einhalb Jahre, die seit dem erfolgreichen „Playing The Angel“ ins Land gezogen sind. Was hat uns diese Band eigentlich nach fast 30 Jahren noch zu erzählen. Nun, nicht mehr sooo viel. Depeche Mode sind eine gut funktionierende Firma, die aber, und das muss man ihnen lassen, ihr Handwerk versteht. Und da die bekloppten Fans eh jeden Release dreimal kaufen, herrscht bei Dave Gahan, Martin Gore und Andy Fletcher längst kreative Narrenfreiheit, welche sie auch bei „Sounds Of The Universe“ wieder ausleben. „Universe“ ist eine konsequente Weiterentwicklung der letzten Alben und schließt sich nach dem durchwachsenen eher „Exciter“ von 2001 an. Der hier zelebrierte Retro-Klang beruht auf dem verstärkten Einsatz von alten Analog-Synthesizern, die sich zu einem großen Ganzen zusammenfügen und ein Klangbild erzeugen, welches immer wieder Akzente aus vergangenen DM Phasen aufweist. „In Sympathy“ klingt nach „Exciter“, während „Hole To Feed“ Ansätze von „Violator“ beinhaltet oder das Instrumental „Spacewalker“ direkt als Outtake aus dem Jahr 1982 durchgehen kann. Und obwohl wie beim Vorgänger wieder Ben Hilliar an den Reglern saß, klingt „Sounds Of The Universe“ wesentlich klarer, kompakter und vor allem besser. Der Retro-Sound wird hier nicht erzwungen, sondern wirkt ganz natürlich, als hätten Band und Produzent endlich verstanden, wie man miteinander umgehen muss. Die Songs ordnen sich stärker dem Gesamtklang unter, als bisher, was aber vollkommen okay ist. Denn die Songs sind zwar keine durchgängigen Meisterwerke, wie zur Hochphase der Band, aber dennoch durchgängig hochwertig, diesmal wieder mit stärkeren Gospel- und Blueseinflüssen. Der flehende Opener „In Chains“ regt einen zum Mitklatschen an, „Little Soul“ fleht noch im Dunkeln, während „In Sympathy“ anschließend das Licht rein lässt und dies schließlich in „Peace“, einem der bisher wohl optimistischsten Songs der Band und einem wunderbaren Zusammenspiel von Gahan und Gore mündet. Die Band hat ihren Frieden gefunden, auch mit sich. Und über was sollen sie auch noch schreiben, wenn sie eigentlich alle Laster, Drogenskandale und Streitigkeiten der letzten Jahre mittlerweile abgelegt haben? Die drei zufriedenen und millionenschweren Familienväter müssen der Welt nichts mehr beweisen. Also lautet die Motivation zum Weitermachen wohl nur nach Spaß und das entwickeln neuer Idee. Live vielleicht nicht mehr, da liefern Depeche Mode mittlerweile eine überraschungsarme Las-Vegas-Show ab. Aber im Studio sucht man noch nach neuen Impulsen. Ein Blick in die Studio-Making-Of’s bestätigt diesen Eindruck. Also arbeiten Depeche Mode weiterhin daran, ihre Musik weiterzuentwickeln, neue Elemente einzubauen und vor allem die Akzente etwas anders zu setzen. Natürlich wirkt die reduzierte Version von „Come Back“, welche man schon auf der Homepage anschauen konnte, eingängiger, aber die verzerrten Gitarrenwände auf dem Album untermauern die Verzweiflung in Gahan’s Flehen und bringen eine spannende Dissonanz ins Popgerüst. „Sounds Of The Universe“ ist vermutlich immer noch nicht das große Alterswerk der Band, aber sie kommen einem solchen Album wieder näher und es macht Hoffnung, dass diese Band auch jenseits der 50 noch eine großartige Musikmomente schaffen kann. Und wenn nicht, dann erwischen sie hoffentlich den richtigen Moment zum Abtreten. Verdient hätten sie es sich ja schon längst.
Anhören: „In Chaines“, „Wrong“, „In Sympathy“, „Come Back“, „Jezebel“,
12. Röyksopp “Junior”
Röyksopp wurden 2009 zehn! Auch nicht schlecht, denn mit nur 3 Alben in dieser Dekade hat das norwegische Elektroduo ordentlich Eindruck hinterlassen. Und als ideales Geburtstagsgeschenk gibt es gleich „Junior“ auf dem die Band ihren Stellenwert in Sachen Elektronische Musik noch mal ordentlich unterstreicht. Das Duo liefert uns hier echt tollen Elektropop ab, mit viel Atmosphäre und Melodien. Während der Opener, das lustige „Happy Up Here“ noch eher zum Schmunzeln einlädt, folgt gleich im Anschluss mit der Robyn-Kollaboration „The Girl And The Robot“ ein anständiger Elektro-Superhit, der ordentlich zum Tanzen einlädt! Und Robyn ist nicht der einzige weibliche Feature-Gast. Natürlich ist Karin Dreijer Andersson aka Fever Ray wieder dabei, welche uns durch das wunderbar tanzbare Pop-Märchen „This Must Be It“, sowie das wirre „Tricky Tricky“ leitet. Und Lykke Li ist auch dabei. Und die wundervolle Anneli Drecker, die auf der tollen Ballade „You Don’t Have A Clue“ ihr können unter Beweis stellt. Ja, Röyksopp wissen, wie man die skandinavischen Pop-Ladies anlockt. Wie immer durchzieht das ganze Album ein Hauch von Melancholie, mal mehr tanzbar, mal weniger. Der knarzende Groove von „Vision One“ ist typisch Röyksopp, während ruhigere Instrumental-Tracks wie „Röyksopp Forever“ oder „Silver Cruiser“ Röyksopp von der Seite präsentieren, die man auf den ersten Alben an ihnen schätzen gelernt hat. Hier wird mal wieder gezeigt zu welcher Musikalität elektronische Musik fähig sein kann. Mit dem ruhigen Lounge-Debüt „Melody A.M.“ hat das nicht mehr so viel zu tun, denn Röyksopp haben sich dem Pop zugewendet und wollen zeigen, was man alles feines damit anstellen kann. „Junior“ hat eine ganz eigene Atmosphäre und besonders das Zusammenspiel aus den elektronischen Spielereien und den sehr gut ausgewählten weiblichen Gastsängerinnen weiß hier zu gefallen. Außerdem passiert hier unentwegt an allen Ecken und Enden etwas. Nein, diese Jungs (mitsamt ihren Mädels) haben es echt drauf. Elektronische Musik kann so viel mehr sein, als nur Clubfutter und Bubblegumpop-Soundgewand. Röyksopp bleiben auch in diesem Jahr eine Ausnahmeerscheinung im Genre und begeistern mit Ideenreichtum und Abwechslung. Die Geburt von „Junior“ ist also bestens geglückt, nächstes Jahr soll das etwas düstere und ruhigere Gegenstück „Senior“ folgen. Ich bin sehr gespannt darauf und somit recht zuversichtlich, dass man auch noch ein 20jähriges Jubiläum feiern wird.
Anhören: “The Girl And The Robot”, “This Must Be It”, “Röyksopp Forever”, “You Don’t Have A Clue”, “True To Life”
11. Muse “The Resistance”
Getreu dem alten Leitspruch von Oliver Twist, haben es sich Muse zur Aufgabe gemacht, immer ein klein wenig mehr zu wollen. Der Drang der Band, immer neue Elemente ihrem seit jeher ausladenden Alternative Rock hinzuzufügen spornt sie seit nunmehr 10 Jahren zu immer neuen Höchstleistungen an. Der Erfolg hat sich mittlerweile auch eingestellt. Die größeren Hallen werden auch abseits der englischen Heimat voll, denn der Ruf, eine der besten Live Bands der Welt zu sein spricht sich langsam rum. Die richtigen Songs dafür haben sie eh schon immer gehabt. So geht auch das diesjährige fünfte Studioalbum „The Resistance“ den Weg kontinuierlich weiter, den zuletzt „Black Holes & Revelations“ eingeschlagen hatte. Die Band öffnet sich neuen Spielarten, die Produktion wird ausgereifter, der raue, wütende Zorn der Anfangstage weicht einer stärkeren Musikalität und Pop-Affinität. Das wird sicher vielen Fans der ersten Stunde nicht sonderlich gefallen, aber Muse haben sich halt weiter entwickelt, schließlich sind sie ja auch keine 20 mehr. So ist „The Resistance“ natürlich wieder ein gewohnt pompöses, ausladendes Album geworden, welches dem uneingeschränkt sympathischen Größenwahn frönt. Nach dem thematischen Ausflug in ferne Galaxien auf dem letzten Album, geht es diesmal etwas bodenständiger zu. Aber nur etwas, denn inhaltlich geht’s diesmal neben den üblichen Themen Liebe, Sex und Zärtlichkeit natürlich auch um revolutionäre und politische Umbrüche. Den gelebten Widerstand gegen was auch immer. Bereits die Single „Uprising“ kündet davon. Im Titeltrack fleht Matthew Bellamy anschließend die Angebetete an, dass ihre Liebe ihr Widerstand gegen all den Rest ist. Ach, wie kitschig. Der Rest überrascht dann immer mal wieder. Denn mit dem lässig groovenden „Undisclosed Desires“ präsentiert man sich erstmals vollkommen ohne Gitarren- oder Pianospiel. Herausgekommen ist ein Song, den Timbaland besser nicht hätte hinbekommen können. Urbaner Elektro-R’n’B inklusive sexy Text. Eine Art konsequente Weiterentwicklung von „Supermassive Black Hole.“ „United States of Eurasia“ gibt dann all den Leuten Recht, die Muse seit jeher als neue Queen ansehen, während sich das schwülstige „Guiding Light“ irgendwo zwischen U2 und fiesem 80er-Schwulst bewegt. Inklusive viel Hall auf den Drums. Und immer gibt’s noch eine Schippe mehr. So endet „The Resistance“ standesgemäß mit der dreiteiligen „Exogenesis“-Symphonie, welche noch einmal die klassisch-virtuose Seite der Band mit ihrem bekannten Gitarrensound verbindet. Gerade der finale Teil, „Redemption“ ist ein wundervoller Ausklang, der kaum hätte besser sein können. Was soll eigentlich nach so einem Ausstand noch kommen? Muse entwickeln ihren Kunstrock konsequent weiter und betonen diesmal, auch aufgrund der erstmaligen Verwendung eines echten Orchesters, ihre symphonische Seite viel stärker. Insgesamt ein sehr stimmungsvolles und abwechslungsreiches Album, das unglaublich dick aufträgt, aber die dürfen das halt. Vielleicht fehlt am Ende noch der letzte konsequente Schritt, um es perfekt zu machen, aber man braucht ja noch Stoff für die nächsten Alben, versteht sich.
Anhören: “Resistance”, “Undisclosed Desires”, “United States Of Eurasia”, “Exogenesis Symphony Pt. 3: Redemption”
rhododendron - 26. Dez, 15:32

 Also, wie wählt man die nun eigentlich die liebste aller Platten aus den vergangenen zehn Jahren? Wie geht man dabei vor? Vielleicht sollte man am Ende, das Album nehmen, welches den größten Eindruck bei einem hinterlassen hat, sowohl damals beim Release, als auch heute noch. Das Album, welches einen am meisten geprägt und bewegt hat, welches einen in den richtigen Momenten begleitet hat, an die man sich gern oder auch weniger gern zurückerinnert. Dabei kann man ja durchaus den Stellenwert in der Pophistorie außen vor lassen. Und während ich so beim Aufstellen der Top 100 immer wieder über so etwas nachdachte, kam mir am Ende immer wieder nur ein Titel in den Sinn: „A Weekend In The City“! Das zweite Bloc Party Album ist mein Meisterwerk dieser Dekade, ohne „Wenn“ und „Aber“… während die Welt in diesem Kontext immer gern auf das wegweisende Debüt „Silent Alarm“ schielt wird gern übersehen, welch Genialität der Nachfolger musikalisch und inhaltlich zu bieten hat. Und vielleicht ist es am Ende Schicksal, als ich damals alkoholtrunken kurz nach Mitternacht das Teil erstmals in meinen mp3-Player packte und aufdrehte. Dem frühen Internet-Leak sei dank! So hatte ich mir „Weekend“ für 2007 aufgespaart, vielleicht schon wissend, was es mir bedeuten würde. Na ja, war, glaub ich in jener Nacht ein unfreiwillig komisches Bild, dass ich auf den Elbwiesen abgab.
Also, wie wählt man die nun eigentlich die liebste aller Platten aus den vergangenen zehn Jahren? Wie geht man dabei vor? Vielleicht sollte man am Ende, das Album nehmen, welches den größten Eindruck bei einem hinterlassen hat, sowohl damals beim Release, als auch heute noch. Das Album, welches einen am meisten geprägt und bewegt hat, welches einen in den richtigen Momenten begleitet hat, an die man sich gern oder auch weniger gern zurückerinnert. Dabei kann man ja durchaus den Stellenwert in der Pophistorie außen vor lassen. Und während ich so beim Aufstellen der Top 100 immer wieder über so etwas nachdachte, kam mir am Ende immer wieder nur ein Titel in den Sinn: „A Weekend In The City“! Das zweite Bloc Party Album ist mein Meisterwerk dieser Dekade, ohne „Wenn“ und „Aber“… während die Welt in diesem Kontext immer gern auf das wegweisende Debüt „Silent Alarm“ schielt wird gern übersehen, welch Genialität der Nachfolger musikalisch und inhaltlich zu bieten hat. Und vielleicht ist es am Ende Schicksal, als ich damals alkoholtrunken kurz nach Mitternacht das Teil erstmals in meinen mp3-Player packte und aufdrehte. Dem frühen Internet-Leak sei dank! So hatte ich mir „Weekend“ für 2007 aufgespaart, vielleicht schon wissend, was es mir bedeuten würde. Na ja, war, glaub ich in jener Nacht ein unfreiwillig komisches Bild, dass ich auf den Elbwiesen abgab. 
 Das schöne an dieser Top-100-Liste ist wohl am Ende, dass sie zwar trotzdem die üblichen Verdächtigen am Start hat, aber immer mal wieder zwischendrin Alben auftauchen, die der Außenstehende nicht so auf der Rechnung hatte. Denn am Ende ist es meine Liste und meine Favouriten. Und während sicher einige Musikkenner das 2003er Debütalbum der kanadischen Stills als ganz okayes Debüt mit der flotten Hitsingle „Still In Love Song“ abstempeln, geh ich einenn anderen Weg. Nicht nur ist besagter Hit in meinen Augen relativ überbewertet, nein, sondern „Logic Will Break Your Heart“ hat genau das Gegenteil von seinem Titel gemacht, nämlich mein Herz gewonnen. Und so ist es am Ende ganz selbstverständlich mein zweitliebstes Album der vergangenen Jahre. Und es ist wirklich meines, hab ich nach wie vor das Gefühl, eben deshalb, weil es kaum jemand kennt. Was spricht nun also für die Vizeposition der Stills? Nun, es ist exakt eben jener Mix aus tollen Songs und der Lebensphase, in welchem ich auf dieses Werk traf. Ich glaub, am Ende muss ich Chrischie danken, welcher das Album erst unserem „Fall On Deaf Ears“ gegeben hat, welcher es dann an mich weiter reichte. Doch es vergingen noch ein paar Monate, bis ich überhaupt reinhörte. Und ich weiß gar nicht mehr, was letztendlich den Anstoß gab und wann das Album letztendlich bei mir Klick machte. Es muss irgendwann im Sommer 2006 gewesen sein, wo mich dieses Album aus dem Nichts recht flott umgehauen hatte. Man benutzt ja gern mal so blöde Emo-Sätze wie „Dieses Album hat mein Leben gerettet“. Ist eigentlich schrecklich abgedroschen, aber in Anbetracht der Tatsache, dass ich ihn bisher noch nicht in den Top 100 angewendet hab und weil’s einfach wahr ist, drück ich mal auf die Emo-Tube. Ja, dieses Album war und ist mir extrem wichtig und einer der Gründe, warum Musik in meinen Augen unser kostbarstes Kulturgut ist. Und das seh vielleicht ich nur so, denn hier handelt es sich ja um kein symphonisches Großwerk, sondern um Indierock mit leichtem New-Wave-Einschlag. Warum funktioniert dieses Album bei mir? Vielleicht, weil es die Thematik ist… 12 Songs über gebrochene Herzen mit unterschiedlichsten textlichen Herangehensweisen. Der fulminante Opener „Lola Stars And Stripes“ mischt apokalyptische Ängste mit Zweisamkeit, während gleich im Anschluss im lyrisch prägnantesten Song des Albums, „Gender Bombs“ alles zusammengefasst wird… „The Girl will school you“. Und Logik zerbricht eben das Herz, genauso wie Veränderungen am Ende schlecht sind. Der gleichnamige dritte Song beendet den tollen Hit-Hattrick gleich zu Beginn der Platte. Hier bin ich schon hin und weg. Der Rest begeistert auch, seien es die etwas rockigen Nummern wie „Love and Death“ oder „Allison Krausse“ oder die ruhigen Momente, wie „Let’s Roll“ oder „Fevered“, welche wie eine warme Sommernacht für Seelenfrieden suchen. An den sehr seltsamen Wendungen, die hier fallen, wird klar, dass es mir recht schwer fällt den Wert und die Faszination von „Logic Will Break Your Heart“ in rationalen Beschreibungen festzuhalten. Vielleicht versuch ich’s noch mal. Wir haben 12 sehr gute bis geniale Indierock-Songs, die aber gern mal ein wenig Richtung Wave schielen, ohne aber dabei wie Interpol und Konsorten zu klingen. Was bleibt ist die melancholische Grundstimmung, die zwar gelegentlich Ausbrüche von Optimismus zulässt, aber damit nie übertreibt. Etwas Dunkles kann diese Musik nicht von der Hand weisen. Aber gerade die Tatsache, dass sich das insgesamt irgendwie mit den hellen Aspekten der Musik die Wage hält, macht dieses Album so hörenswert. Der Verlust der Liebe bleibt zentrales Thema dieses Albums. Und so stellt Sänger Tim Fletcher am Ende resigniert fest: “Some things last forever, why can't this last forever?”. Das der Abschlusssong “Yesterday, Never Tomorrow” am Ende doch irgendwie etwas fröhlich Leichtes an sich hat, kann gern als Ironie der Tatsache gesehen werden. Auf „Logic Will Break Your Heart“ wird im ganz großen Maßstab gelitten, auch wenn es sich das Album eben nicht anmerken lässt. Nachdem der Nachfolger ein ziemliches Desaster wurde und man die Stills eigentlich schon hätte abschreiben können, stimmte das 2008er Album „Oceans Will Rise“ wieder versöhnliche Töne an, so dass vielleicht auch in Zukunft noch mit den jungen Herren aus Kanada zu rechnen ist. Und selbst wenn nicht, dann bleibt am Ende dieser kleine, wunderbare Indierock-Schatz, der für immer einen großen Stellenwert in meinem Leben haben wird. Und vielleicht funktioniert das nur in bestimmten Situationen, in denen man selber das durchmacht, was diese Platte uns erzählt. Vielleicht funktioniert’s aber auch anders. Wer also bisher noch nichts von der Existenz dieses Albums mitbekommen hat, dem empfehle ich das Anhören hiermit uneingeschränkt. Danke, liebe Stills!
Das schöne an dieser Top-100-Liste ist wohl am Ende, dass sie zwar trotzdem die üblichen Verdächtigen am Start hat, aber immer mal wieder zwischendrin Alben auftauchen, die der Außenstehende nicht so auf der Rechnung hatte. Denn am Ende ist es meine Liste und meine Favouriten. Und während sicher einige Musikkenner das 2003er Debütalbum der kanadischen Stills als ganz okayes Debüt mit der flotten Hitsingle „Still In Love Song“ abstempeln, geh ich einenn anderen Weg. Nicht nur ist besagter Hit in meinen Augen relativ überbewertet, nein, sondern „Logic Will Break Your Heart“ hat genau das Gegenteil von seinem Titel gemacht, nämlich mein Herz gewonnen. Und so ist es am Ende ganz selbstverständlich mein zweitliebstes Album der vergangenen Jahre. Und es ist wirklich meines, hab ich nach wie vor das Gefühl, eben deshalb, weil es kaum jemand kennt. Was spricht nun also für die Vizeposition der Stills? Nun, es ist exakt eben jener Mix aus tollen Songs und der Lebensphase, in welchem ich auf dieses Werk traf. Ich glaub, am Ende muss ich Chrischie danken, welcher das Album erst unserem „Fall On Deaf Ears“ gegeben hat, welcher es dann an mich weiter reichte. Doch es vergingen noch ein paar Monate, bis ich überhaupt reinhörte. Und ich weiß gar nicht mehr, was letztendlich den Anstoß gab und wann das Album letztendlich bei mir Klick machte. Es muss irgendwann im Sommer 2006 gewesen sein, wo mich dieses Album aus dem Nichts recht flott umgehauen hatte. Man benutzt ja gern mal so blöde Emo-Sätze wie „Dieses Album hat mein Leben gerettet“. Ist eigentlich schrecklich abgedroschen, aber in Anbetracht der Tatsache, dass ich ihn bisher noch nicht in den Top 100 angewendet hab und weil’s einfach wahr ist, drück ich mal auf die Emo-Tube. Ja, dieses Album war und ist mir extrem wichtig und einer der Gründe, warum Musik in meinen Augen unser kostbarstes Kulturgut ist. Und das seh vielleicht ich nur so, denn hier handelt es sich ja um kein symphonisches Großwerk, sondern um Indierock mit leichtem New-Wave-Einschlag. Warum funktioniert dieses Album bei mir? Vielleicht, weil es die Thematik ist… 12 Songs über gebrochene Herzen mit unterschiedlichsten textlichen Herangehensweisen. Der fulminante Opener „Lola Stars And Stripes“ mischt apokalyptische Ängste mit Zweisamkeit, während gleich im Anschluss im lyrisch prägnantesten Song des Albums, „Gender Bombs“ alles zusammengefasst wird… „The Girl will school you“. Und Logik zerbricht eben das Herz, genauso wie Veränderungen am Ende schlecht sind. Der gleichnamige dritte Song beendet den tollen Hit-Hattrick gleich zu Beginn der Platte. Hier bin ich schon hin und weg. Der Rest begeistert auch, seien es die etwas rockigen Nummern wie „Love and Death“ oder „Allison Krausse“ oder die ruhigen Momente, wie „Let’s Roll“ oder „Fevered“, welche wie eine warme Sommernacht für Seelenfrieden suchen. An den sehr seltsamen Wendungen, die hier fallen, wird klar, dass es mir recht schwer fällt den Wert und die Faszination von „Logic Will Break Your Heart“ in rationalen Beschreibungen festzuhalten. Vielleicht versuch ich’s noch mal. Wir haben 12 sehr gute bis geniale Indierock-Songs, die aber gern mal ein wenig Richtung Wave schielen, ohne aber dabei wie Interpol und Konsorten zu klingen. Was bleibt ist die melancholische Grundstimmung, die zwar gelegentlich Ausbrüche von Optimismus zulässt, aber damit nie übertreibt. Etwas Dunkles kann diese Musik nicht von der Hand weisen. Aber gerade die Tatsache, dass sich das insgesamt irgendwie mit den hellen Aspekten der Musik die Wage hält, macht dieses Album so hörenswert. Der Verlust der Liebe bleibt zentrales Thema dieses Albums. Und so stellt Sänger Tim Fletcher am Ende resigniert fest: “Some things last forever, why can't this last forever?”. Das der Abschlusssong “Yesterday, Never Tomorrow” am Ende doch irgendwie etwas fröhlich Leichtes an sich hat, kann gern als Ironie der Tatsache gesehen werden. Auf „Logic Will Break Your Heart“ wird im ganz großen Maßstab gelitten, auch wenn es sich das Album eben nicht anmerken lässt. Nachdem der Nachfolger ein ziemliches Desaster wurde und man die Stills eigentlich schon hätte abschreiben können, stimmte das 2008er Album „Oceans Will Rise“ wieder versöhnliche Töne an, so dass vielleicht auch in Zukunft noch mit den jungen Herren aus Kanada zu rechnen ist. Und selbst wenn nicht, dann bleibt am Ende dieser kleine, wunderbare Indierock-Schatz, der für immer einen großen Stellenwert in meinem Leben haben wird. Und vielleicht funktioniert das nur in bestimmten Situationen, in denen man selber das durchmacht, was diese Platte uns erzählt. Vielleicht funktioniert’s aber auch anders. Wer also bisher noch nichts von der Existenz dieses Albums mitbekommen hat, dem empfehle ich das Anhören hiermit uneingeschränkt. Danke, liebe Stills! Schluss mit Leise! Nach dem wunderbar ruhigen Debüt „Parachutes“ setzten die britischen Newcomer von Coldplay mit dem Nachfolger ein deutliches Ausrufezeichen und meldeten damit auch unfreiwillig den Anspruch an, für die ganze Welt zu spielen. Es dauerte zwar noch ein wenig bis es dann endgültig vorbei war mit dem Geheimtipp, aber so lange gehörte „A Rush Of Blood To The Head“ mit allein! Ja, a bin ich egoistisch und erinner mich gern an die Zeit zurück, als man Coldplay noch nicht mit diversen Hausfrauen, BWL-Studenten und Fußballstadien teilen musste. Auch nach sieben Jahren bleibt das Zweitwerk in Sachen Coldplay das Maß aller Dinge. Die eigene Messlatte sozusagen. Dafür reichen schon die fünf Minuten von „Politik“ zu Beginn. Die besten fünf Minuten, die diese Band bisher komponiert hat. Ein Meileinstein, der mir auch heute noch immer einen Schauer über den Rücken jagt. Besonders ab Minute Vier. Einfach mal selbst testen. Mit stampfendem Rhythmus erzählt uns Lockenkopf Chris Martin vom Chaos in der Welt, bevor er die Angebetete im befreienden Schlussteil anfleht „And give me love over this“. Auch bei Coldplay ist ja bekanntlich all you need love. Das kann man für naiv halten, aber mein Gott… seid doch auch mal ein wenig romantisch, liebe Zweifler. Natürlich sind auf diesem Album auch die großen Radiohits „In My Place“ und „Clocks“ dabei, die man vielleicht mittlerweile nicht mehr hören kann, wobei aber gerade Letzterer ein unbestreitbarer Superhit ist. Eine Pianomelodie für die Ewigkeit. Und natürlich das wundervolle „The Scientist“, welches sich in triefenden Entschuldigungs-Phrasen wälzt und somit Angriffsfläche für alle Hater gibt. So wie das ganze Album. Alles, was man an Coldplay lieben kann findet sich hier. Und eben alles, was man an dem Quartett hassen kann. Ist mir aber relativ schnuppe, muss ich sagen. Nachdem sich das Debüt ja, wie bereits erwähnt, eher akustisch gab, drehen Coldplay die Gitarren nun etwas auf und wagen auch mal ein paar Überraschungen, wie das wüst-chaotische „A Whisper“ oder das treibende „God Put A Smile Upon Your Fance“. Zwischendurch muss aber natürlich immer wieder Platz für die wunderbar melodischen Piano-Britpop-Nummern sein. „Warning Sign“ schrammt zwar ziemlich am Kitsch vorbei, aber irgendwie nimmt man Martin den reumütigen Liebhaber in jeder Sekunde ab. „When the truth is, I miss you so.“ Wie kann ich da nur wiederstehen? Auch der Titeltrack überzeugt mit starken Texten und einem tollen, großflächigen Soundgewand, bevor der Abschluss “Amsterdam” dann noch mal kurz ruhigere Töne anschlägt, nur um am Ende noch mal richtig auszubrechen. Man merkt einfach, wie viel die Band seit dem Debüt gelernt hat und wie viel sie bereit ist, zu riskieren und auszuprobieren. So halten sich die gefühlvollen, zerbrechlichen Momente mit dem großen Pathos erstaunlich gut die Wage. Im Prinzip ist „Rush of Blood“ ein typisches zweites Album, wie es hier im Countdown immer wieder aufgetaucht ist. Man nimmt die besten Elemente des Vorgängers und macht sie einfach, auch aufgrund der Erfahrung, etwas größer und ausgereifter. Der Erfolg kommt dann ja meist von allein und kam ja in dem Fall später auch. „A Rush Of Blood To The Head“ wird vermutlich für alle Zeit mein Lieblings Coldplay-Album bleiben. Allein aus nostalgischen und biographischen Gründen werden es alle späteren Alben schwer haben, da ran zu kommen. Mit diesem Album wurden Coldplay, zumindest für einen Zeitraum von 2 Jahren oder so, zu meiner Lieblingsband und sind auch heute noch ganz weit vorn in meiner Gunst, egal wie groß sie sind und wie groß sie noch werden. Ich hab das glaub ich, weiter hinten bei „Viva La Vida“ geschrieben… wenn eine Band weltweit so viel Anerkennung findet, dann hat das vielleicht auch manchmal was mit musikalischer Qualität zu tun. Und wer an dieser zweifelt, sollte sich doch bitte noch einmal dieses tolle Meisterwerk mit seinen wundervollen Popsongs anhören und überzeugt werden.
Schluss mit Leise! Nach dem wunderbar ruhigen Debüt „Parachutes“ setzten die britischen Newcomer von Coldplay mit dem Nachfolger ein deutliches Ausrufezeichen und meldeten damit auch unfreiwillig den Anspruch an, für die ganze Welt zu spielen. Es dauerte zwar noch ein wenig bis es dann endgültig vorbei war mit dem Geheimtipp, aber so lange gehörte „A Rush Of Blood To The Head“ mit allein! Ja, a bin ich egoistisch und erinner mich gern an die Zeit zurück, als man Coldplay noch nicht mit diversen Hausfrauen, BWL-Studenten und Fußballstadien teilen musste. Auch nach sieben Jahren bleibt das Zweitwerk in Sachen Coldplay das Maß aller Dinge. Die eigene Messlatte sozusagen. Dafür reichen schon die fünf Minuten von „Politik“ zu Beginn. Die besten fünf Minuten, die diese Band bisher komponiert hat. Ein Meileinstein, der mir auch heute noch immer einen Schauer über den Rücken jagt. Besonders ab Minute Vier. Einfach mal selbst testen. Mit stampfendem Rhythmus erzählt uns Lockenkopf Chris Martin vom Chaos in der Welt, bevor er die Angebetete im befreienden Schlussteil anfleht „And give me love over this“. Auch bei Coldplay ist ja bekanntlich all you need love. Das kann man für naiv halten, aber mein Gott… seid doch auch mal ein wenig romantisch, liebe Zweifler. Natürlich sind auf diesem Album auch die großen Radiohits „In My Place“ und „Clocks“ dabei, die man vielleicht mittlerweile nicht mehr hören kann, wobei aber gerade Letzterer ein unbestreitbarer Superhit ist. Eine Pianomelodie für die Ewigkeit. Und natürlich das wundervolle „The Scientist“, welches sich in triefenden Entschuldigungs-Phrasen wälzt und somit Angriffsfläche für alle Hater gibt. So wie das ganze Album. Alles, was man an Coldplay lieben kann findet sich hier. Und eben alles, was man an dem Quartett hassen kann. Ist mir aber relativ schnuppe, muss ich sagen. Nachdem sich das Debüt ja, wie bereits erwähnt, eher akustisch gab, drehen Coldplay die Gitarren nun etwas auf und wagen auch mal ein paar Überraschungen, wie das wüst-chaotische „A Whisper“ oder das treibende „God Put A Smile Upon Your Fance“. Zwischendurch muss aber natürlich immer wieder Platz für die wunderbar melodischen Piano-Britpop-Nummern sein. „Warning Sign“ schrammt zwar ziemlich am Kitsch vorbei, aber irgendwie nimmt man Martin den reumütigen Liebhaber in jeder Sekunde ab. „When the truth is, I miss you so.“ Wie kann ich da nur wiederstehen? Auch der Titeltrack überzeugt mit starken Texten und einem tollen, großflächigen Soundgewand, bevor der Abschluss “Amsterdam” dann noch mal kurz ruhigere Töne anschlägt, nur um am Ende noch mal richtig auszubrechen. Man merkt einfach, wie viel die Band seit dem Debüt gelernt hat und wie viel sie bereit ist, zu riskieren und auszuprobieren. So halten sich die gefühlvollen, zerbrechlichen Momente mit dem großen Pathos erstaunlich gut die Wage. Im Prinzip ist „Rush of Blood“ ein typisches zweites Album, wie es hier im Countdown immer wieder aufgetaucht ist. Man nimmt die besten Elemente des Vorgängers und macht sie einfach, auch aufgrund der Erfahrung, etwas größer und ausgereifter. Der Erfolg kommt dann ja meist von allein und kam ja in dem Fall später auch. „A Rush Of Blood To The Head“ wird vermutlich für alle Zeit mein Lieblings Coldplay-Album bleiben. Allein aus nostalgischen und biographischen Gründen werden es alle späteren Alben schwer haben, da ran zu kommen. Mit diesem Album wurden Coldplay, zumindest für einen Zeitraum von 2 Jahren oder so, zu meiner Lieblingsband und sind auch heute noch ganz weit vorn in meiner Gunst, egal wie groß sie sind und wie groß sie noch werden. Ich hab das glaub ich, weiter hinten bei „Viva La Vida“ geschrieben… wenn eine Band weltweit so viel Anerkennung findet, dann hat das vielleicht auch manchmal was mit musikalischer Qualität zu tun. Und wer an dieser zweifelt, sollte sich doch bitte noch einmal dieses tolle Meisterwerk mit seinen wundervollen Popsongs anhören und überzeugt werden.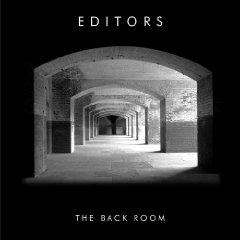 Auf die Musikpresse sollte man sich sowieso nicht verlassen. Der Name „Editors“ tauchte natürlich im schicksalsträchtigen Jahr 2005 auch irgendwann unter all den vielen neuen Gitarrenbands auf. Und als mich Blogkollege „The Fall On Deaf Ears“ irgendwann im Sommer ’05 mal darauf ansprach, plapperte ich munter dem Schnabel der Presse nach… „Das is doch nur so’n billiger Interpol-Klon, oder?“ Ich Unwissender, ich! Es sollte noch ein halbes Jahr dauern, bis die Zeit reif für mich und die Editors war. So trat die Band während einer Phase in mein Leben, in dem ich sie wirklich brauchte. Mehr muss dazu auch nicht gesagt werden, das ist ja hier kein Kummerkasten. Dann auf einmal hörte ich „The Back Room“, welches ich auch noch einige Wochen lang versehentlich als „Black Room“ titulierte und irgendwann kam der Moment, wo es „Klick“ machte und an allen Vorurteilen vorbei direkt ins Herz ging. Mit Interpol hat das alles auch nicht wirklich was zu tun. Denn seit wann steht das Kriterium „Melancholischer Wave Rock mit tiefer Männerstimme“ denn für einen Vergleich? Nein, die Editors waren schon immer etwas dringlicher, konkreter. Während Interpol mit der Introspektive immer noch liebäugeln, wollen die Editors mit ihrer Trauer und Verzweiflung Außenwirkung erzeugen. Allein der Albumbeginn ist mit dem schnellen „Lights“, sowie den Hits „Munich“ und „Blood“ bereits unglaublich zackig, energiegeladen und tanzbar. Und so geht es auch weiter, wenngleich die Band natürlich zu den richtigen Momenten auf die Bremse tritt. Und immer wieder fleht die markante Stimme von Tom Smith in den Nachthimmel. „I wanted to see this for myself“ singt er im melancholischen „Fall“ vor sich hin. Inwieweit Smiths Stimme etwas mit Paul Banks zu tun haben soll, dass dürfen andere entscheiden. Sie ist makant, klar, kraftvoll und doch voller Schmerz. Live gibt Smith den unfreiwilligen Frontmann, der immer wieder im Kampf mit sich selbst zu sein scheint. Wenngleich sich das in den letzten Jahren deutlich gebessert hat. Seine Texte sind einfach gehalten, aber mehrdeutig interpretierbar. So haben die Songs die seltene Gabe, für jeden ihrer Hörer etwas anderes zu bedeuten. Wer oder was die „Disease“ ist, auf welche man im genialen „Bullets“ verzichten soll, muss jeder selbst entscheiden. Und auch die blutenden Hände aus den Fabriken oder die Arme, mit denen man Menschen in der eigenen Stadt Willkommen heißen soll sind Interpretationssache. Doch was am Ende bleibt ist ein Gefühl von Melancholie, Verzweiflung und sicher auch etwas innerer Zerrissenheit, welche die Songs, trotz ihrer poppigen Eingängigkeit durchweht. Für ein Debütalbum eine erstaunliche Leistung. Alle elf Tracks sind hervorragend und auch vielseitig. Für ein trauriges Balladenalbum ist „The Back Room“ zu schnell, für ein Tanzalbum aber auch zu ruhig. Für mich als Fan von düsterem New-Wave-Pop natürlich ideal. Das Debüt der Editors ist eines der besten der ausgehenden Dekade voller großer, wichtiger Songs, die mir sehr viel bedeuten. Und nicht nur die auf dem Album. All die B-Seiten, welche vor und während dieses Debüts entstanden, sind von ähnlicher Birllanz. Es seien nur mal Songs wie „Let Your Good Heart Lead Your Home“ oder “Come Share The View” ans Herz gelegt. Und all diese Songs habe ich damals so gern und intensiv gehört... und das über einen wirklich langen Zeitraum. Die trunkenen Momente, die ich zusammen mit den Editors verbracht hab lassen sich eh nicht mehr an zwei Händen abzählen. Aber es war gut so und ist es heute immer noch. Auch die beiden Nachfolger haben meine Vermutungen bestätigt, dass diese Band viel Potential nach oben hat. Dieses einmalige A-ha-Gefühl aber bleibt trotzdem für immer mit „The Back Room“ verbunden. Und dabei bealsse ich es auch. „I’ve got so much to tell you but so little time”.
Auf die Musikpresse sollte man sich sowieso nicht verlassen. Der Name „Editors“ tauchte natürlich im schicksalsträchtigen Jahr 2005 auch irgendwann unter all den vielen neuen Gitarrenbands auf. Und als mich Blogkollege „The Fall On Deaf Ears“ irgendwann im Sommer ’05 mal darauf ansprach, plapperte ich munter dem Schnabel der Presse nach… „Das is doch nur so’n billiger Interpol-Klon, oder?“ Ich Unwissender, ich! Es sollte noch ein halbes Jahr dauern, bis die Zeit reif für mich und die Editors war. So trat die Band während einer Phase in mein Leben, in dem ich sie wirklich brauchte. Mehr muss dazu auch nicht gesagt werden, das ist ja hier kein Kummerkasten. Dann auf einmal hörte ich „The Back Room“, welches ich auch noch einige Wochen lang versehentlich als „Black Room“ titulierte und irgendwann kam der Moment, wo es „Klick“ machte und an allen Vorurteilen vorbei direkt ins Herz ging. Mit Interpol hat das alles auch nicht wirklich was zu tun. Denn seit wann steht das Kriterium „Melancholischer Wave Rock mit tiefer Männerstimme“ denn für einen Vergleich? Nein, die Editors waren schon immer etwas dringlicher, konkreter. Während Interpol mit der Introspektive immer noch liebäugeln, wollen die Editors mit ihrer Trauer und Verzweiflung Außenwirkung erzeugen. Allein der Albumbeginn ist mit dem schnellen „Lights“, sowie den Hits „Munich“ und „Blood“ bereits unglaublich zackig, energiegeladen und tanzbar. Und so geht es auch weiter, wenngleich die Band natürlich zu den richtigen Momenten auf die Bremse tritt. Und immer wieder fleht die markante Stimme von Tom Smith in den Nachthimmel. „I wanted to see this for myself“ singt er im melancholischen „Fall“ vor sich hin. Inwieweit Smiths Stimme etwas mit Paul Banks zu tun haben soll, dass dürfen andere entscheiden. Sie ist makant, klar, kraftvoll und doch voller Schmerz. Live gibt Smith den unfreiwilligen Frontmann, der immer wieder im Kampf mit sich selbst zu sein scheint. Wenngleich sich das in den letzten Jahren deutlich gebessert hat. Seine Texte sind einfach gehalten, aber mehrdeutig interpretierbar. So haben die Songs die seltene Gabe, für jeden ihrer Hörer etwas anderes zu bedeuten. Wer oder was die „Disease“ ist, auf welche man im genialen „Bullets“ verzichten soll, muss jeder selbst entscheiden. Und auch die blutenden Hände aus den Fabriken oder die Arme, mit denen man Menschen in der eigenen Stadt Willkommen heißen soll sind Interpretationssache. Doch was am Ende bleibt ist ein Gefühl von Melancholie, Verzweiflung und sicher auch etwas innerer Zerrissenheit, welche die Songs, trotz ihrer poppigen Eingängigkeit durchweht. Für ein Debütalbum eine erstaunliche Leistung. Alle elf Tracks sind hervorragend und auch vielseitig. Für ein trauriges Balladenalbum ist „The Back Room“ zu schnell, für ein Tanzalbum aber auch zu ruhig. Für mich als Fan von düsterem New-Wave-Pop natürlich ideal. Das Debüt der Editors ist eines der besten der ausgehenden Dekade voller großer, wichtiger Songs, die mir sehr viel bedeuten. Und nicht nur die auf dem Album. All die B-Seiten, welche vor und während dieses Debüts entstanden, sind von ähnlicher Birllanz. Es seien nur mal Songs wie „Let Your Good Heart Lead Your Home“ oder “Come Share The View” ans Herz gelegt. Und all diese Songs habe ich damals so gern und intensiv gehört... und das über einen wirklich langen Zeitraum. Die trunkenen Momente, die ich zusammen mit den Editors verbracht hab lassen sich eh nicht mehr an zwei Händen abzählen. Aber es war gut so und ist es heute immer noch. Auch die beiden Nachfolger haben meine Vermutungen bestätigt, dass diese Band viel Potential nach oben hat. Dieses einmalige A-ha-Gefühl aber bleibt trotzdem für immer mit „The Back Room“ verbunden. Und dabei bealsse ich es auch. „I’ve got so much to tell you but so little time”. Nach all der Dunkelheit und Trauer der letzten Alben ist es jetzt mal wieder Zeit, die Vorhänge zu öffnen und das Licht hinein zu lassen. Und wie es den Raum flutet. Am besten, in jenem Moment, als die Gitarren des schleppenden „Words“ beginnen zu spielen und es wirkt, als ob aller Balast dieser Welt von einem Abfällt. „There Goes The Fear“. Bereits der zweite Song dieses Albums ist eine überlebensgroße Hymne, die mich auch heute in richtigen Momenten noch zu tränen rühren kann. Ein Song, der weinend zurückblickt, aber auch voller Hoffnung den Blick Richtung Zukunft wendet. Wir reden hier natürlich die ganze Zeit vom famosen Zweitwerk der Doves aus Manchester. „The Last Broadcast“ ist ein Meisterwerk der Gattung Britpop, voller Größe, Gefühle und den genau richtigen Songs. Der pefekte Einstieg in meine fünf besten Alben des Jahrzehnts. Um die Genilität dieses Albums zu verstehen und zu spüren sollte man in erster Linie keine Angst vor großen Gesten und Breitwand Stadionrock haben, denn anders als noch beim sehr chilligen Debüt „Lost Souls“ geht es auf dem Nachfolger einfach eine Spur größer zur Sache. Mehr Musik, mehr Emotionen, mehr Sound. Doch an keiner Stelle wirkt das übertrieben. Dafür sorgt stets die wundervoll warme Stimme von Jimi Goodwin, die den Hörer am Boden hält und nach hause fühlt. Selbst wenn zwischendurch eben bei „There Goes The Fear“ oder „Satellites“ der Gospelchor gleich noch mit dabei ist. „Satellites ahead, so hold on!“ Nie klangen Durchhalteparolen so überzeugend, wie auf diesem Album. Zwar durchweht alle Songs auch gern mal etwas Melancholie, doch stets findet sich in den warmen Gesangsflächen und dem verspielten Britpop auch etwas Beruhigendes und Bewegendes. Die ruhigen Momente, wie „M62 Song“ oder „Last Broadcast“ überzeugen ebenfalls, dienen aber meist nur als kurze Pausen zwischen den fulminanten Hymnen. „Pounding“ ist neben „Fear“ das zweite große Ausrufezeichen auf der Platte! Ein Jahrhundertsong, der mit jedem stampfenden Takt „Ja“ zum Leben sagt. „We don't mind
Nach all der Dunkelheit und Trauer der letzten Alben ist es jetzt mal wieder Zeit, die Vorhänge zu öffnen und das Licht hinein zu lassen. Und wie es den Raum flutet. Am besten, in jenem Moment, als die Gitarren des schleppenden „Words“ beginnen zu spielen und es wirkt, als ob aller Balast dieser Welt von einem Abfällt. „There Goes The Fear“. Bereits der zweite Song dieses Albums ist eine überlebensgroße Hymne, die mich auch heute in richtigen Momenten noch zu tränen rühren kann. Ein Song, der weinend zurückblickt, aber auch voller Hoffnung den Blick Richtung Zukunft wendet. Wir reden hier natürlich die ganze Zeit vom famosen Zweitwerk der Doves aus Manchester. „The Last Broadcast“ ist ein Meisterwerk der Gattung Britpop, voller Größe, Gefühle und den genau richtigen Songs. Der pefekte Einstieg in meine fünf besten Alben des Jahrzehnts. Um die Genilität dieses Albums zu verstehen und zu spüren sollte man in erster Linie keine Angst vor großen Gesten und Breitwand Stadionrock haben, denn anders als noch beim sehr chilligen Debüt „Lost Souls“ geht es auf dem Nachfolger einfach eine Spur größer zur Sache. Mehr Musik, mehr Emotionen, mehr Sound. Doch an keiner Stelle wirkt das übertrieben. Dafür sorgt stets die wundervoll warme Stimme von Jimi Goodwin, die den Hörer am Boden hält und nach hause fühlt. Selbst wenn zwischendurch eben bei „There Goes The Fear“ oder „Satellites“ der Gospelchor gleich noch mit dabei ist. „Satellites ahead, so hold on!“ Nie klangen Durchhalteparolen so überzeugend, wie auf diesem Album. Zwar durchweht alle Songs auch gern mal etwas Melancholie, doch stets findet sich in den warmen Gesangsflächen und dem verspielten Britpop auch etwas Beruhigendes und Bewegendes. Die ruhigen Momente, wie „M62 Song“ oder „Last Broadcast“ überzeugen ebenfalls, dienen aber meist nur als kurze Pausen zwischen den fulminanten Hymnen. „Pounding“ ist neben „Fear“ das zweite große Ausrufezeichen auf der Platte! Ein Jahrhundertsong, der mit jedem stampfenden Takt „Ja“ zum Leben sagt. „We don't mind Standortbestimmung gleich zu Beginn. “We ain’t going to the town, we’re going to the city!” Nur, damit jeder Bescheid weißt. Die große Stadt gilt ja seit jeher als beliebtes Motiv im Post Punk. Entweder als herbeigesehnter Zufluchtsort voll pusierendem Leben oder als urbane Personifizierung der Einsamkeit. Kann man bekanntlich halten wie man will. Interpol selber kommen ja aus New York, weshalb schon mal klar sein sollte, zu welcher Gruppierung sie gehören. Nachdem das 2002er Debüt „Turn On The Bright Lights“ noch etwas im New Yorker Großstadtnebel versank, wird die Band auf dem Nachfolger „Antics“ konkreter, direkter und stellenweise sogar erfreulich eingängig ohne ihren bekannten und beliebten Sound zu vernachlässigen. Es ist das übliche Phänomen des zweiten Albums. Man macht irgendwie alles ein wenig konkreter, besser und zielgerichteter. Ein warmer Orgelteppich empfängt uns auf „Next Exit“, bevor wir uns mit „Evil“ direkt rein wagen. Da schüttelt das Quartett aus NYC mal eben einfach so einen lässigen Hit aus dem Ärmel. Und es kommen noch ein paar mehr. Die Singles „Slow Hands“ und „C’Mere“ seien da sicher erwähnt. Der Sound sitzt... ohne Wenn und Aber. Carlos D’s groovige Bassläufe treffen auf die markanten Gitarren eines Daniel Kessler, welche bewusst in den Vordergrund rücken und trotz düsteren, sterilen Klanges viel Seele vermitteln. Es ist einfach dieser ganze Sound. Bspw. dieser treibende Schlagzeugbeat auf “Not Even Jail”, den Sam Fogorino fast sechs Minuten so konsequent durchzieht. Und dazu diese forschen Gitarren und der harte Bass, sowie das flehen von Paul Banks. „Remember take hold of your time here, give some meanings to the means” Es ist die Form von New-Wave-Whatever-Rock, die ich so liebe. Und Interpol spielen sie nahe an der Perfektion. Die raue Wut einiger Songs des Vorgängers weicht ein wenig der besseren Produktion, was aber keinen Widerspruch darstellt. Das tolle „Take You On A Cruise“ wechselt im Verlaufe sein Wesen dezent und „A Time To Be Small“ beschließt das Album mit melancholischer Schwere. Trotz all der Energie und Spannung innerhalb der Musik von Interpol durchweht sie auch stets eine düstere Melancholie. Auch eine Art Zerissenheit und Verzweiflung, welche gerade in den Texten und Gesangslinien von Frontmann Paul Banks immer wieder deutlich wird. Interpol sind die Summe ihrer Teile. Diese Summe hat es auf drei Alben geschafft, mich immer wieder zu fesseln. Die Tatsache, dass sie die einzige Band ist, die es geschafft hat, gleich drei Alben hier in den Top 30 zu platzieren spricht auch eine deutliche Sprache. Vielleicht ist der Nachfolger „Our Love To Admire“ etwas perfekter, aber „Antics“ war mein erstes Interpol-Album, jenes Werk, dass den Anfang machte mit zehn ausnahmslos wundervollen, düsteren New-Wave-Songs voller Kraft und Gefühl. Die wunderbaren Momente, welche mir die Band in den letzten Jahren live oder auf Platte verschafft hat, kann ich gar nicht mehr an zwei Händen abzählen. Ich verdanke dieser Band sehr viel und ziehe deshalb meinen Hut vor der Genialität, die sich hoffentlich auch wieder auf Album Nummer Vier im nächsten Jahr zeigen wird.
Standortbestimmung gleich zu Beginn. “We ain’t going to the town, we’re going to the city!” Nur, damit jeder Bescheid weißt. Die große Stadt gilt ja seit jeher als beliebtes Motiv im Post Punk. Entweder als herbeigesehnter Zufluchtsort voll pusierendem Leben oder als urbane Personifizierung der Einsamkeit. Kann man bekanntlich halten wie man will. Interpol selber kommen ja aus New York, weshalb schon mal klar sein sollte, zu welcher Gruppierung sie gehören. Nachdem das 2002er Debüt „Turn On The Bright Lights“ noch etwas im New Yorker Großstadtnebel versank, wird die Band auf dem Nachfolger „Antics“ konkreter, direkter und stellenweise sogar erfreulich eingängig ohne ihren bekannten und beliebten Sound zu vernachlässigen. Es ist das übliche Phänomen des zweiten Albums. Man macht irgendwie alles ein wenig konkreter, besser und zielgerichteter. Ein warmer Orgelteppich empfängt uns auf „Next Exit“, bevor wir uns mit „Evil“ direkt rein wagen. Da schüttelt das Quartett aus NYC mal eben einfach so einen lässigen Hit aus dem Ärmel. Und es kommen noch ein paar mehr. Die Singles „Slow Hands“ und „C’Mere“ seien da sicher erwähnt. Der Sound sitzt... ohne Wenn und Aber. Carlos D’s groovige Bassläufe treffen auf die markanten Gitarren eines Daniel Kessler, welche bewusst in den Vordergrund rücken und trotz düsteren, sterilen Klanges viel Seele vermitteln. Es ist einfach dieser ganze Sound. Bspw. dieser treibende Schlagzeugbeat auf “Not Even Jail”, den Sam Fogorino fast sechs Minuten so konsequent durchzieht. Und dazu diese forschen Gitarren und der harte Bass, sowie das flehen von Paul Banks. „Remember take hold of your time here, give some meanings to the means” Es ist die Form von New-Wave-Whatever-Rock, die ich so liebe. Und Interpol spielen sie nahe an der Perfektion. Die raue Wut einiger Songs des Vorgängers weicht ein wenig der besseren Produktion, was aber keinen Widerspruch darstellt. Das tolle „Take You On A Cruise“ wechselt im Verlaufe sein Wesen dezent und „A Time To Be Small“ beschließt das Album mit melancholischer Schwere. Trotz all der Energie und Spannung innerhalb der Musik von Interpol durchweht sie auch stets eine düstere Melancholie. Auch eine Art Zerissenheit und Verzweiflung, welche gerade in den Texten und Gesangslinien von Frontmann Paul Banks immer wieder deutlich wird. Interpol sind die Summe ihrer Teile. Diese Summe hat es auf drei Alben geschafft, mich immer wieder zu fesseln. Die Tatsache, dass sie die einzige Band ist, die es geschafft hat, gleich drei Alben hier in den Top 30 zu platzieren spricht auch eine deutliche Sprache. Vielleicht ist der Nachfolger „Our Love To Admire“ etwas perfekter, aber „Antics“ war mein erstes Interpol-Album, jenes Werk, dass den Anfang machte mit zehn ausnahmslos wundervollen, düsteren New-Wave-Songs voller Kraft und Gefühl. Die wunderbaren Momente, welche mir die Band in den letzten Jahren live oder auf Platte verschafft hat, kann ich gar nicht mehr an zwei Händen abzählen. Ich verdanke dieser Band sehr viel und ziehe deshalb meinen Hut vor der Genialität, die sich hoffentlich auch wieder auf Album Nummer Vier im nächsten Jahr zeigen wird.